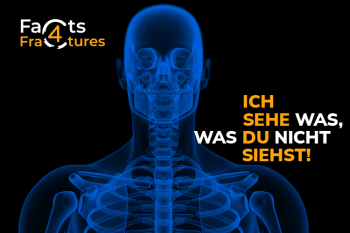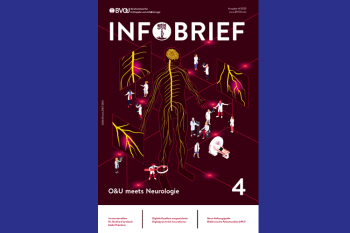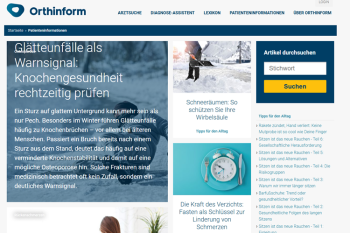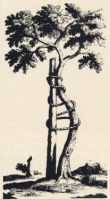Stuttgart – Die Kollegen aus O + U sind eine „sehr starke, qualifizierte und einflussreiche Gruppe“ in den Gremien der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Baden-Württemberg, sagt deren Vorstandsvorsitzender Dr. Norbert Metke. Metke ist Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Rehabilitationswesen. Der KV-Vorstand über seine Tour-de-Ländle als Werbung für die laufende KV-Wahl, warum ein neuer Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) derzeit unnötig ist und weshalb ein kollegiales Gespräch mit den Krankenhäusern über Notfallpatienten überfällig ist.
BVOU.net: Herr Dr. Metke, was tut die KV Baden-Württemberg dafür, dass die Beteiligung an der nächsten KV-Wahl möglichst hoch ausfällt?
Norbert Metke: Wir versuchen die Kolleginnen und Kollegen unter anderem damit von der Wichtigkeit der KV-Wahl zu überzeugen, dass wir eine umfangreiche Tour-de-Ländle als KV Baden-Württemberg veranstaltet haben. Wir waren dafür in 16 Bezirken und haben uns als Vorstand vorgestellt. Aus diesem Anlass haben wir auch aktuelle Probleme der Kolleginnen und Kollegen aufgegriffen und daraus abgeleitet, warum sie ein Interesse an den Aufgaben der KV haben sollten: Wir sind zuständig fürs Honorar und die Honorarverteilung, für Wirtschaftlichkeitsprüfungen, Qualitätssicherungen und anderes.
Unsere Botschaft ist: Das alles machen wir für Euch. Manche sagen auch: gegen Euch. Auf jeden Fall gilt: Wenn man die Richtung der KV mitbestimmen will, dann sollte man wählen gehen – denn das KV-Wahlergebnis bestimmt die Richtung der KV.
BVOU.net: Ähneln sich die Fragen – oder interessieren die Ärzte bei Ihrer Tour-de-Ländle immer unterschiedliche Themen?
Metke: Sie ähneln sich. Zuletzt betrafen viele Fragen die Überschreitung des individuellen Heilmittelbudgets. Da hatten wir ein Problem und mussten viele Ärzte warnen. Ansonsten diskutieren wir immer dieselben Themen: GOÄ-Reform, EBM-Reform, Honorar allgemein – und in Baden-Württemberg derzeit auch richtgrößenablösende Regelungen. Ganz wichtig ist vielen auch das Anti-Korruptionsgesetz mit seinen Auswirkungen.
BVOU.net: Kommen zu den Terminen eher KV-kritische Ärztinnen und Ärzte?
Metke: Das würde ich nicht sagen. Der KV-Vorstand hat den Eindruck, dass die Kolleginnen und Kollegen derzeit relativ zufrieden sind. Die strittigen Themen, die am Anfang meiner Amtszeit diskutiert wurden, nämlich Honorarverfall, Existenznöte, chaotische Zustände im Bereitschaftsdienst, zu wenig Repräsentation durch die KV – an denen haben wir gearbeitet. Die werden aktiv nicht mehr angesprochen.
Das Anti-Korruptionsgesetz hat zu tiefer Verunsicherung beigetragen
BVOU.net: Und was treibt die Ärzte noch um?
Metke: Im Moment ist es das Anti-Korruptionsgesetz. Viele sehen sich unter Generalverdacht gestellt und haben Angst, dass auch sogenannte normale Handlungen schon unter Korruptionsverdacht stehen. Das Gesetz hat zu einer tiefen Verunsicherung der Ärzteschaft beigetragen. Das müssen wir jetzt erst einmal bewältigen.
BVOU.net: Wie gehen Sie damit um?
Metke: Wir haben eine erste Information auf unserer Homepage eingestellt und werden im Verlauf des Sommers zusammen mit der Landesärztekammer Baden-Württemberg und Staatsanwälten eine Informationsbroschüre herausgeben zu dem, was erlaubt ist und was nicht.
BVOU.net: Wie läuft die Wahl bisher?
Metke: Wir mussten ja die Wahlfrist verlängern, weil wir einen Teil der Unterlagen neu drucken mussten. Wie die Wahlbeteiligung sich nun entwickeln wird, erfährt der KV-Vorstand aber grundsätzlich nicht.
BVOU.net: Wie hoch war die Wahlbeteiligung bei Ihnen denn das letzte Mal?
Metke: Wir lagen bei rund 50 Prozent, was nicht schlecht ist. Damals war aber das Honorardesaster in Folge des damals neuen EBM ein heftig diskutiertes Thema, und schon deshalb war die Mobilisierung hoch.
BVOU.net: Wer ist besonders schwer zum Wählen zu bewegen?
Metke: Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die meinen: Meine eine Stimme bewegt doch nichts. Das ist aber falsch, denn indem ich wähle, kann ich am Ende schon Richtungen in der KV beeinflussen. Ich kann einerseits nachvollziehen, dass sich mancher Arzt von den Gesamtbürokratismen des Systems so erschlagen fühlt, dass er findet: Jetzt nicht noch etwas ausfüllen. Da muss man Richtgrößen kennen, an den Rote-Hand-Brief denken, das Honorar könnte noch besser sein – manch einer hat erst einmal keine Lust, sich auch noch mit berufspolitischen Themen zu befassen und sich mit den KV-Wahlen auseinanderzusetzen.
Wir haben eine im positiven Sinn politisierte Ärzteschaft
Andererseits haben wir eine im positiven Sinn politisierte Ärzteschaft bei uns in Baden-Württemberg, also sehr aktive Berufsverbände und Berufsorganisationen, ob Hausarztverband, Facharztverbände, Medi oder andere. Sie alle mobilisieren ihre Mitglieder. Aber auch deren Appelle erreichen eben nicht jeden. Hinzu kommt, dass ein Teil unserer Mitglieder ja schon am Ende seines Berufslebens steht und vielleicht denkt: Na, die letzten paar Jahre wird schon noch alles funktionieren.
BVOU.net: BVOU-Präsident Flechtenmacher wird nicht müde zu betonen, dass man sich zur Wahl stellen oder wenigstens wählen gehen sollte, damit das eigene Fach tatsächlich in den KV-Gremien repräsentiert wird. Wie bewerten Sie das?
Metke: Vertreter von O + U sind zahlenmäßig sehr gut in den verschiedenen Gremien der KV repräsentiert. Ich empfinde diese Kollegen als sehr starke, qualifizierte und einflussreiche Gruppe.
BVOU.net: Was bringt es dem KV-Vorstand, wenn viele Facharztgruppen in den KV-Gremien vertreten sind?
Metke: Man ist sicher in seinen Entscheidungen. Und da wir eine sehr enge Gremienrückkoppelung haben, gerade mit den Fachausschüssen, garantiert die Rückkoppelung mit möglichst vielen Facharztgruppen, dass man als KV-Vorstand Entscheidungen trifft, die akzeptiert werden – sowohl von der Vertreterversammlung wie von der gesamten niedergelassenen Ärzteschaft.
Wir haben kein Problem mit dem EBM, sondern mit der Geißel der Budgetierung
BVOU.net: Welche Themen werden Ihrer Meinung nach in der nächsten Legislaturperiode besonders wichtig werden?
Metke: Da müssen Sie trennen zwischen Bundes- und Landesthemen. Was die Bundesthemen anbelangt, so ist unser großes Anliegen: Wir wollen in Baden-Württemberg keinen neuen EBM. Wir haben doch kein Problem mit dem EBM, wir haben Probleme mit der Geißel der Budgetierung. Einen neuen EBM einzuführen, ohne dass mehr Geld zur Verfügung gestellt wird, ist unnötig.
Ein neuer EBM bedeutet immer einen riesigen Aufwand innerhalb der Praxis. Sie müssen selbst umdenken, Sie müssen die Helferinnen informieren, Sie brauchen neue Software, die viel Geld kostet, und Sie bekommen erhebliche Kalkulationsunsicherheiten in der Praxis. EBM-Reformen bei Budgetneutralität führen immer zu Umverteilungen zwischen und innerhalb der Fachgruppen. Und das brauchen wir nicht. Ich meine, dass man sich auf Basis eines breiten Konsenses erst einmal der Budgetierungsfrage annehmen muss. Wenn dieses Problem gelöst ist, braucht man sicher auch einen neuen EBM – aber in dieser Reihenfolge, nicht in einer anderen.
BVOU.net: Und was sind für Sie KV-spezifische Themen für die nächste Legislaturperiode?
Metke: Dazu zählt für mich die Richtgrößenablösung. Die planen wir, zunächst für den Bereich der Arzneimittel. Wir wollen da die Praxisindividualität berücksichtigten, also quasi rund 20.000 individuelle Praxis-Richtgrößen errechnen. Dahinter steckt die Überlegung, dass man so die Patientenmorbidität und Versorgungschwerpunkte einer Praxis angemessen abbilden will und diese nicht durch hohe Regresse bestrafen. Da sind wir in den Verhandlungen mit den Krankenkassen auch sehr weit. Ob wir die Heilmittel-Richtgrößen zusätzlich angehen, ist in der Diskussion.
Außerdem wollen wir neue Prüfvereinbarungen vorsehen, die Amnestiezeiträume vorsehen. Das muss man sich in etwa vorstellen wie das Flensburger Modell für Autofahrer. Ein weiteres Aufgabenfeld ist zweifelsohne, dass die Bürger sich zunehmend über Beratungsportale im Internet informieren, die niedergelassene Ärzteschaft aber derzeit in diesen Beratungsportalen nicht sichtbar ist.
Wir wollen uns zudem der Situation annehmen, dass immer mehr Patienten während der Praxisöffnungszeiten in Klinikambulanzen gehen. Im Krankenhausstrukturgesetz ist ja vorgesehen, dass die Krankenhausvergütung für ambulante Leistungen angehoben werden soll zulasten der budgetierten Gesamtvergütung. Wir wollen deshalb ein breiteres Versorgungsangebot schaffen, damit Patienten während der Sprechstundenzeiten nicht weiterhin in die Notaufnahme gehen, sondern in die präsente ambulante Praxis. Und wir wollen fordern, dass Patienten in Mitverantwortung genommen werden für die von ihnen veranlassten Leistungen.
BVOU.net: Sie haben doch in Baden-Württemberg Bereitschaftsdienstpraxen an Krankenhäusern eingeführt, in denen Patienten, die keine stationären Notfälle sind, von Niedergelassenen versorgt werden.
Metke: Ja, wir haben das in Deutschland größte System für solche Praxen während der sprechstundenfreien Zeiten. Wir betreiben 120 Notfalldienstpraxen, von denen ca. 100 Eigenbetriebe der KV sind.
Im Referentenentwurf des Krankenhausstrukturgesetzes war vorgesehen, dass die KVen auch während der Sprechstundenzeiten verpflichtet werden, sogenannte Portalpraxen an Krankenhäusern zu unterhalten. Das wären in Baden-Württemberg mehr als 250 gewesen, weil wir so viele Krankenhäuser haben. Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens ist diese Verpflichtung aber verworfen worden. Das Gebot der Portalpraxen gilt nur noch für die Abendstunden und fürs Wochenende.
Vollabklärung eines Notfalls in der Klinik ist nicht in jedem Fall nötig
BVOU.net: Wie wollen Sie Patienten von den Rettungsstellen der Krankenhäuser fernhalten?
Metke: Der beste Lösungsansatz wäre natürlich, dass der Patient einen Eigenanteil übernimmt, wenn er eigenmächtig ein Krankenhaus ansteuert, ohne ein stationärer Notfall zu sein. Wir stellen ja schließlich die ambulante Grundversorgung sicher, nicht zuletzt durch die 120 Notfallpraxen zu den sprechstundenfreien Zeiten. Und für die Sprechstundenzeiten sind wir gerade dabei, ein Konzept zu entwickeln, damit die Versorgung auf jeden Fall garantiert ist. Mit den Krankenhäusern muss man dann eben ein kollegiales Gespräch führen, dass eine Vollabklärung eines Notfalls in der Klinik nicht in jedem Fall notwendig ist, wenn man diese auch in den niedergelassenen Praxen vornehmen kann.
BVOU.net: Wird das kollegiale Gespräch gelingen?
Metke: Wir haben einen extrem steinigen, aber auch einen extrem erfolgreichen Weg bei der Etablierung der Notfalldienstpraxen hinter uns. Deshalb gehen wir davon aus, dass wir auch einen Konsens für die Problematik der Notfallversorgung am Tag finden werden. Den niedergelassenen Ärzten muss man darlegen: Wenn wir nichts machen, zahlen wir es. Im Schwäbischen verdient man aber lieber etwas, als etwas auszugeben.
(Das Interview führte Sabine Rieser)
Alle Informationen zu den KV-Wahlen im Überblick
Leserkommentare
Dr. med. Wolfgang Stutz, Offenburg:
Wenn die Kollegen aus O + U tatsächlich so eine „sehr starke, qualifizierte und einflussreiche Gruppe“ in den Gremien der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Baden-Württemberg wären wie Herr Metke behauptet, hätten wir nicht weiterhin einen so lächerlich niedrigen Fallwert der Fachgruppe.
Darüber bin ich nicht halb so amused wie Herr Metke immer von seinem Standardkonterfei grinst.
Was immer die Truppe aus O + U in der KV angeblich alles für uns macht, es verbessert unsere wirtschaftliche Situation nicht.
Daher fühle ich mich durch diesen Beitrag verhöhnt! Und mit dieser Meinung stehe ich nicht alleine da.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Stutz