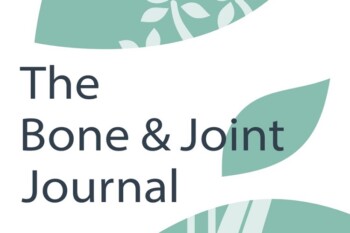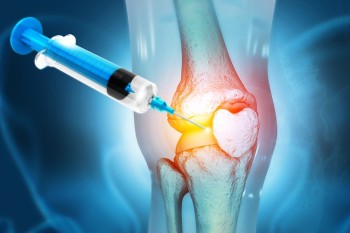Berlin – „Korruption ist unzulässig und auch keine Bagatelle. Allerdings sehe ich mit großer Sorge, dass auch gewollte und sinnvolle Kooperationen kriminalisiert und torpediert werden können.“ Das stellte BVOU-Präsident Dr. Johannes Flechtenmacher beim diesjährigen Symposion der Kaiserin Friedrich-Stiftung Mitte Februar in Berlin klar. Die besten Erfahrungen machten derzeit Juristen, denn eine rechtssichere Beratung sei im Moment nicht möglich. Deshalb bestehe die Gefahr, so Flechtenmacher, dass sich eine Beratung ins Unermessliche ausdehne.
„Zusammenarbeit wird prinzipiell in Frage gestellt“
Der BVOU-Präsident war einer der Referenten bei der zweitätigen Veranstaltung, bei der Juristen und Ärzte traditionell über Themen diskutieren, die beide Berufsgruppen vor Herausforderungen stellen. „Die Zusammenarbeit Praxis – Klinik wird prinzipiell in Frage gestellt“, kritisierte er. „Die Frage ist, was Niedergelassene, die auch an einem Krankenhaus arbeiten, an Honorar bekommen sollten. Wir haben dafür noch keine Korridore.“
An das Thema der angemessenen Vergütung in Kooperationen wagte sich relativ konkret lediglich Dr. jur. Christoph Jansen heran, Fachanwalt für Medizinrecht. Er verwies darauf, dass man bei der Frage nach dem korrekten Handeln verschiedene Fallgruppen in den Blick nehmen müsse. Eine seien niedergelassene Ärzte, die im Krankenhaus gegen Vergütung selbst operierten.
Bei DRG-Anteil als Honorar prüfen, was dafür geleistet wird
Nach Jansens Meinung kommt es beim Arztanteil in den DRG als Basis für ein Honorar in einer Kooperation darauf an, was der Arzt genau macht: Operiert er lediglich? In welchem Umfang ist er auch noch auf der Station tätig? Vom Umfang seiner Tätigkeit hängt es nach Ansicht von Jansen ab, wie hoch sein Honorar sein darf. Die marktüblichen Preise lägen zwischen 15 und 30 Prozent der jeweiligen DRG. Eine GOÄ-Abrechnung ist nach Jansens Auffassung transparenter. Sie stellt aber seines Erachtens auch die äußerste Grenze des Honorars dar. Ab dann werde es bedenklich.
Stichwort ambulante Operationen bei GKV-Patienten: Grundsätzlich hält Jansen hier, was das Honorar betrifft, das vom Krankenhaus vereinnahmte Honorar für die Obergrenze, ein höheres dagegen für kritisch.
Flucht in den Arbeitsvertrag ist keine Sicherheitsgarantie
Die Flucht in den Arbeitsvertrag mit einem Krankenhaus, also eine Teilanstellung, ist seiner Beobachtung nach derzeit ein Weg, der als unschuldig gilt. Aber auch ein solcher lukrativer Vertrag könne möglicherweise schon einen unangemessenen Vorteil darstellen, gab er zu bedenken. Auf Ähnliches hatte zuvor Prof. Dr. jur. Martin Stellpflug von der Berliner Kanzlei Dierks + Bohle verwiesen. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat seinen Worten nach vor kurzem offenbar geäußert, es gehe möglicherweise bei der Diskussion um einen unzulässigen Vorteil in einer Kooperation nicht nur um die Frage, ob für eine Operation eine angemessene Summe Geld geflossen sei oder nicht. Für den Niedergelassenen könne es ja schon ein Vorteil sein, dass er Geld neben seiner Niederlassung verdienen könne, dass er für eine Kooperation ausgewählt worden sei, dass er so eine zusätzliche Erwerbsquelle habe, die andere Ärzte in seinem Bezirk nicht hätten.
BVOU-Präsident Flechtenmacher hatte in seinem Vortrag Klarheit angemahnt. Diskussionen über Ethik und Sittlichkeit müsse man führen, Schweinereien müssten aufhören. Aber: „Für den Patienten muss man ordentliche Kooperationen leben können.“
Weitere Informationen zum Thema finden Sie im Dossier Antikorruption.