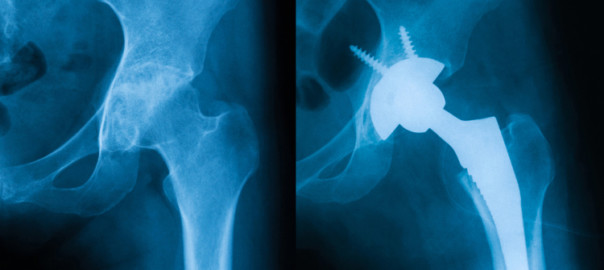Berlin – Die Bundesärztekammer (BÄK) ist derzeit in Gesprächen mit den Fachgesellschaftenund Berufsverbänden, unter anderem auch von O + U, um die Novellierung der Muster-Weiterbildungsordnung voranzutreiben. Sie setzt damit einen Beschluss des jüngsten Deutschen Ärztetags (DÄT) um.
Der DÄT hat beschlossen, dass die Version 2 der Novelle auf der elektronischen Plattform WIKI-BÄK veröffentlicht und zur Kommentierung durch die beteiligten Fachgesellschaften und Berufsverbände sowie die Landesärztekammern freigeschaltet wird. Dabei sollen sich Kammern vor allem mit den „Allgemeinen Inhalten“sowie dem Glossar beschäftigen, während die Fachgesellschaften und Berufsverbände mit den konkreten Inhalten des neuen Entwurfs befassen und kommentieren sollen.
Neu ist, dass die Weiterbildungsinhalte künftig zu kompetenzbasierten Blöcken zusammengefasst werden. Diese gliedern sich in allen Gebieten und Facharztqualifikationen in die Bereiche:
- Grundlagen
- Patientenbezogene Inhalte
- Behandlungsbezogene Inhalte
- Technisch-diagnostische Inhalte.
Für jede einzelne Anforderung in diesen Blöcken werden zwei Level der zu erreichenden Kompetenz definiert:
- Anwendungsbezogene Kenntnisse und Erfahrungen („Kennen und Können“)
- Anwendung und Fertigkeiten („Beherrschen“)
Auch wenn es für die Bezeichnungen noch Optierungspotential gibt, ist der Grundgedanke dieser Aufteilung sehr zu begrüßen. Konkret bedeutet diese Änderung, dass auf Facharztniveau nicht jedes Element bereits beherrscht werden muss und gerade das Erlernen komplexer Eingriffe in eine Zusatzweiterbildung verschoben werden kann. Dies ist ja bereits heute in O + U gelebte Praxis. Dadurch können die Anforderungen im Katalog der Facharztqualifikation realistischer gestaltet werden.
Die neue Weiterbildungsordnung wird also auf die Vermittlung von Inhalten und Kompetenzen fokussieren und auf die Definition von Mindestzeiten verzichten. Dies berücksichtigt sowohl den unterschiedlichen Lernfortschritt des Einzelnen, als auch die Möglichkeiten der Weiterbildungsinstitutionen. Bei den Weiterbildungsstätten wird grundsätzlich nicht mehr zwischen ambulant und stationär unterschieden. Dies soll nur in Ausnahmefällen der Fall sein, wenn bestimmte Leistungen ausschließlich in einem Sektor angeboten werden.
Wenn diese Prämisse konsequent umgesetzt wird muss dies auch Auswirkungen auf die Vergabe der Weiterbildungsermächtigung haben. Auch hier ist dann eine kompetenzorientierte Ermächtigung statt einer Ermächtigung über bestimmte Zeiträume hinweg zu fordern. Damit hätte auch die O + U nach der Novellierung die Chance, 24 Monate Weiterbildung im ambulanten Bereich anzubieten und eine entsprechende finanzielle Förderung zu erhalten.
Der Paradigmenwechsel in der neuen Weiterbildungsordnung von abgeleisteten Zeiten und bestätigten Katalogen hin zu erworbenen Kompetenznetzen sollte von uns als Chance zu mehre Flexibilität und Ehrlichkeit in der Weiterbildung verstanden und aktiv mitgestaltet werden. Die Bundesärztekammer ist offen für die konstruktive Zusammenarbeit mit Fachgesellschaften und Berufsverbänden und hat mit der Version 2 der Novelle eine sehre gute Diskussionsgrundlage geschaffen.
Die neue Weiterbildungsordnung für Ärztinnen und Ärzte sei auf einem guten Weg, hatte Dr. Franz Bartmann beim DÄT in Hamburg betont. Der Vorsitzende der Weiterbildungsgremien der BÄK sagte, wegen der rasanten Weiterentwicklung in der Medizin und wegen sich ändernden Rahmenbedingungen der ärztlichen Berufsausübung sie deine Überarbeitung dringend erforderlich. Kompetenz lasse sich nur inhaltlich abbilden. Weil diese Inhalte nicht immer an ein und derselben Weiterbildungsstätte angeboten werden könnten, müsse die Weiterbildung flexibler werden.
Eine komplette Weiterbildungsermächtigung wird es zukünftig wohl nur noch im sektorübergreifenden Verbund geben.