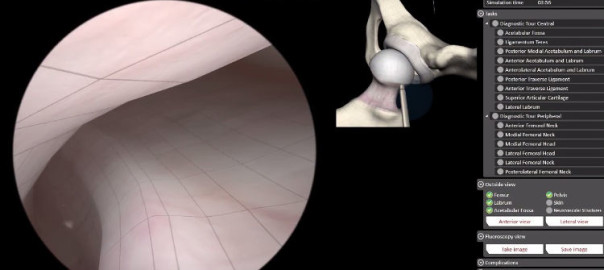Wertheim – Dr. med. Karsten Braun (47) kandidiert für die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in Baden-Württemberg auf der Liste von Medi und ist auf Listenplatz 13 platziert. Er ist in Wertheim in einer fachübergreifenden Gemeinschaftspraxis niedergelassen. In Baden-Württemberg kann man seine Stimme bis 26. Juli abgeben.
7 Fragen an Dr. med. Karsten Braun
BVOU.net: Warum kandidieren Sie für die Vertreterversammlung (VV)?
Braun: Patienten zu behandeln macht Spaß. Das alleine wäre mir aber zu langweilig. Es braucht Kollegen, die auch „das Große und Ganze“ im Blick behalten und die Dinge organisieren, die viele eher als notwendiges Übel betrachten. Ich bin in einer Orthopädenfamilie aufgewachsen, von kleinauf habe ich das berufspolitische Engagement meines Vaters vor Augen gehabt. Irgendwie bin ich dann selber nach und nach da in die Berufspolitik hineingewachsen.
Neben dem Medizinstudium habe ich noch ein Medizinrechtstudium abgeschlossen. Das erweist sich für die realistische Einschätzung rechtlicher Möglichkeiten und politischer Forderungen oft als hilfreich. Nicht zuletzt: Der Vertreterversammlung und den KV-Gremien in Baden-Württemberg droht eine Überalterung, woran ich gern etwas ändern möchte. Mit 47 Jahren gehöre ich eher zu den „Jungen“.
BVOU.net: Wofür steht Ihre Liste?
Braun: Sie ist zunächst untrennbar mit der erfolgreichen Honorarpolitik von Dr. Werner Baumgärtner in den Jahren 1997 bis 2005 verbunden, der auch weiter diese Liste führt. Medi steht für das erfolgreiche und kooperative, fachübergreifende Miteinander von Haus- und Fachärzten und von Kollektiv- und Selektivverträgen, wie zum Beispiel beim erfolgreichen 73c-Orthopädievertrag. Ein brandaktuelles Stichwort ist in Zeiten von E-Health die elektronische Vernetzung. Medizinische Versorgungszentren gehören nach unserer Auffassung in die Hand von freiberuflich tätigen Ärzten. Niederlassung muss sich wieder lohnen. Und das Geld für Ärztenetze muss auch von Krankenkassen und Gemeinden kommen.
BVOU.net: Wofür wollen Sie sich engagieren, wenn Sie gewählt werden?
Braun: Das erste Ziel ist natürlich die Wiederwahl des KV-Führungsduos mit dem Orthopäden Dr. Norbert Metke und dem Allgemeinarzt Dr. Johannes Fechner. Sie könnten ein Vorbild für die Kassenärztliche Bundesvereinigung sein. Versorgungsrealität und Honorar sind natürlich die Dauerthemen für jeden berufspolitisch Engagierten. Hier gilt es, möglichst viele Medi-Ziele durchzubringen, was auch uns Orthopäden gut tun wird. Ich hoffe, dass außer mir noch Burkhard Lembeck und Uwe de Jaager gewählt werden und wir gemeinsam ein Auge darauf haben können, dass die Bedeutung von uns Orthopäden im Versorgungsalltag auch finanziell ausreichend gewürdigt wird.
BVOU.net: Welches Versorgungsthema wollen Sie dann vor allem vorantreiben?
Braun: Ich habe durchaus Spaß an Basisthemen und kann mir Gremienarbeit insbesondere bei den Themen Notfalldienst, Zulassung oder Disziplinarwesen gut vorstellen. Wir Ärzte müssen auch aufpassen, dass wir in Zeiten von Dr. Google und Gesundheits-Apps nicht den Anschluss verlieren und Geld, das wir dringend zur Versorgung benötigen, in sich parallel entwickelnde Sektoren verloren geht. Wir sollten zusehen, dass wir uns bei diesen Themen nicht zu sehr durch unsere Berufsordnung einzwängen lassen, sondern im System Möglichkeit schaffen, diese von den Patienten nachgefragten Gesundheitsleistungen als Ärzte zu erbringen. Das wird sicher noch ein interessantes Thema, insbesondere für die EDV-affine jüngere Generation.
BVOU.net: Und welches Honorarthema wollen Sie vorantreiben?
Braun: Wir brauchen feste, angemessene Preise für unsere qualitativ hochwertige ärztliche Leistung, die die Existenz der Praxen sichern und den Investitionsrückstau beseitigen. Und Planungssicherheit. Budgetierung und Honorarverteilungsmaßstäbe sind grundsätzlich abzulehnen. Hier sind kreative neue Ideen gefragt. Dass so etwas funktionieren kann, zeigen die Selektivverträge in Baden-Württemberg. Ich persönlich finde auch, dass die Unfallversicherer-GOÄ im D-Arztwesen stabil und recht fair für alle Beteiligten funktioniert und teilweise als Vorbild dienen könnte.
BVOU.net: Wie wollen Sie es schaffen, Zeit für die Arbeit in der VV zu erübrigen?
Braun: Ich bin gemeinsam mit meiner Frau und zwei weiteren Kollegen in einer fachübergreifenden Gemeinschaftspraxis für Chirugie, Gefäßchirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie niedergelassen. Lockerer assoziiert sind eine Anästhesistin/Schmerztherapeutin und ein Neurochirurg. Wir können immer ganz gut schieben, wenn einer von uns fehlt. Meine Partner sind da sehr tolerant, weil sie wissen, dass mit mir der Richtige diese Dinge in die Hand nimmt. Und welche Praxis sollte das schon schaffen, einen Partner mal freizustellen, wenn nicht eine größere wie unsere?
BVOU.net: Wie motivieren Sie sich, wenn Sie einmal gar keine Lust auf Berufspolitik haben?
Braun: Eigentlich kommt das nicht vor. Orthopädie ist ein tolles, dynamisches Fach. Es lohnt sich, dafür zu kämpfen, dass sich davon in den Praxen auch etwas abspielt und es dort nicht stagniert. Wir haben uns zum Beispiel mit unserer Praxis zur Zukunftssicherung gerade an der Entwicklung eines großen fachübergreifenden Fachärztehauses beteiligt. Wenn ich mal Ablenkung von der Berufspolitik brauche und mich privat über etwas freuen möchte, dann reicht es schon, wenn ich mir meine beiden Kinder beim Musizieren anhöre. Zur Erholung fahre ich mit der Familie mal in die Berge oder zum Segeln.
Das Interview führte Sabine Rieser. Der BVOU wird in den nächsten Wochen regelmäßig Interviews mit Orthopäden und Unfallchirurgen veröffentlichen, die für die KV-Wahlen kandidieren.
Weiterführende Informationen:
KV-Wahlwerbung: Plakate, Slogans, Hillary-Video
Weitere Interviews:
KV-Wahlen 2016: Die Kandidaten aus O und U im Gespräch