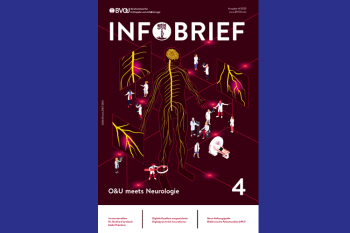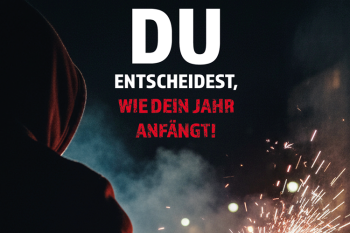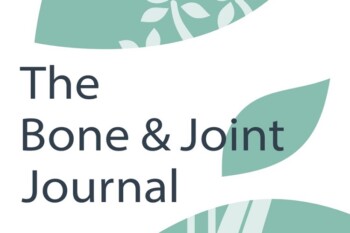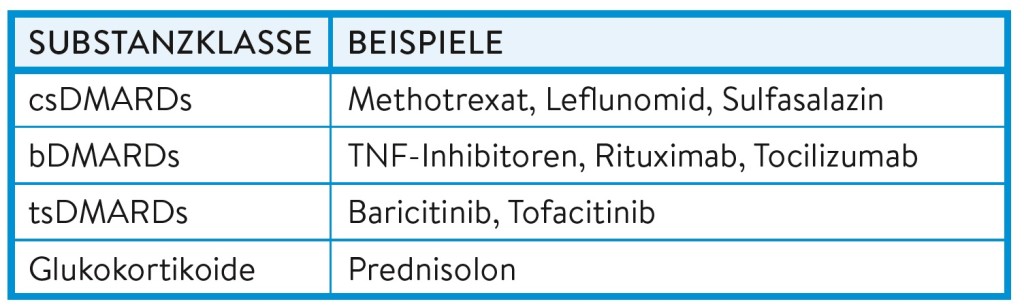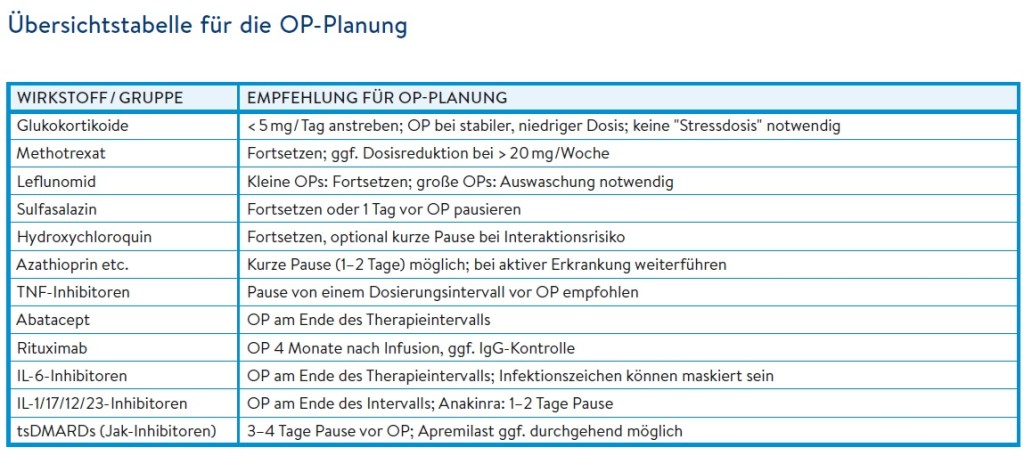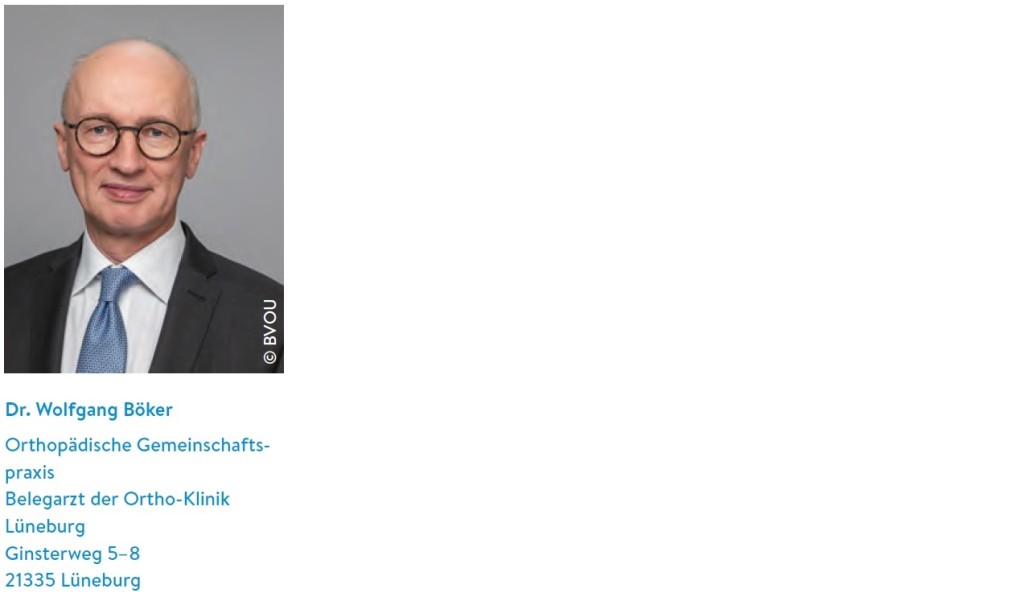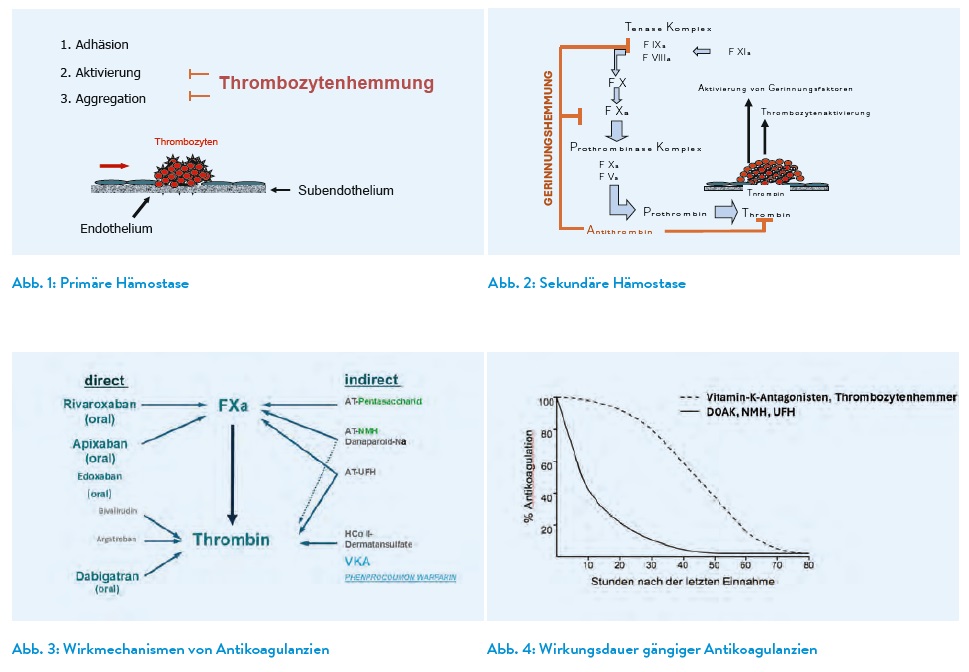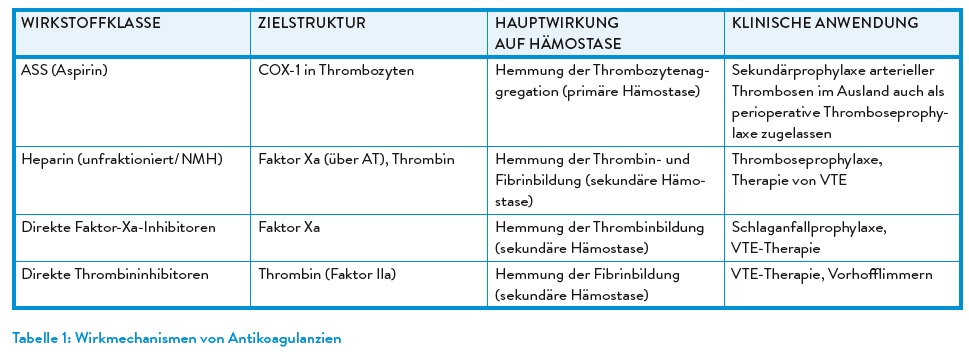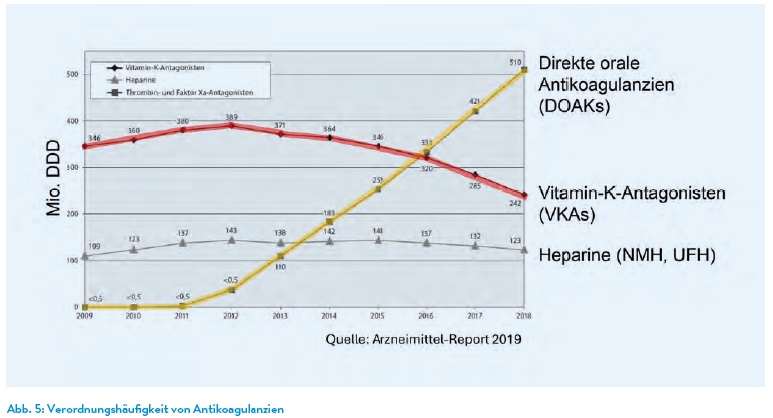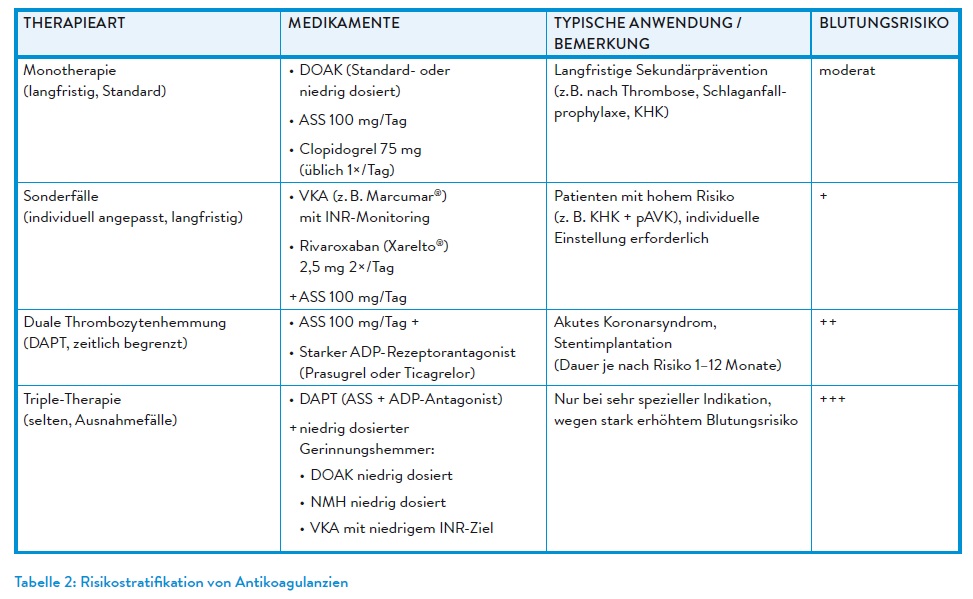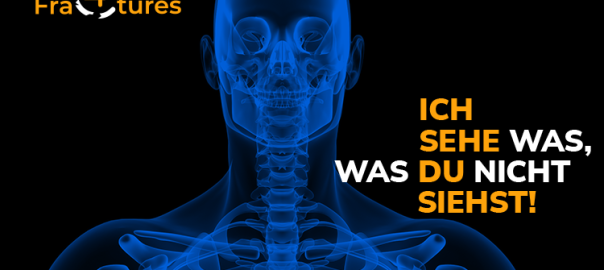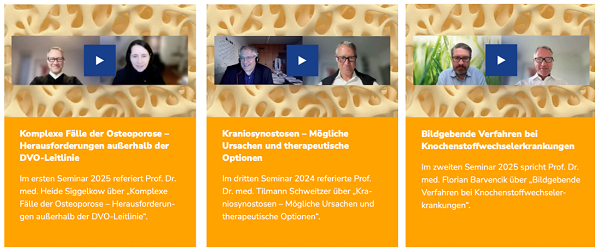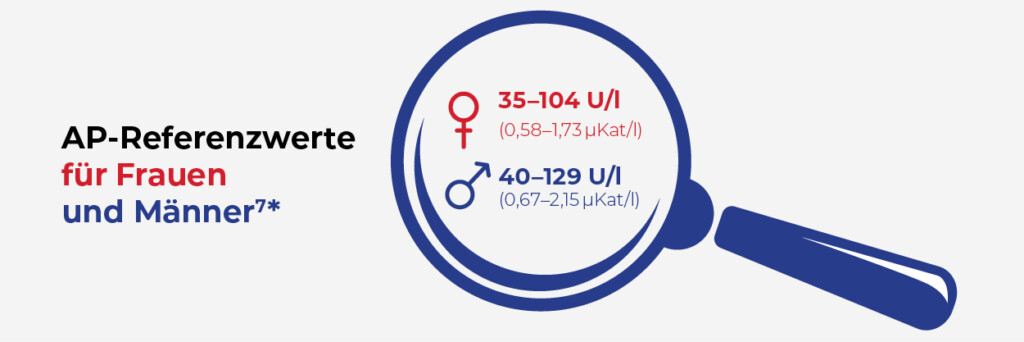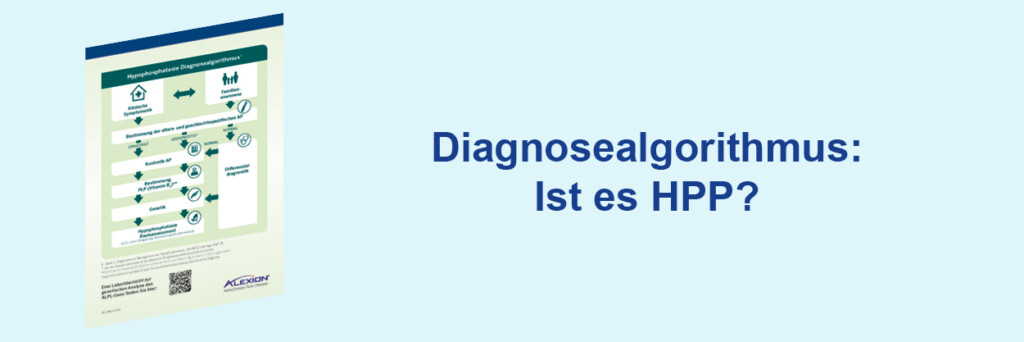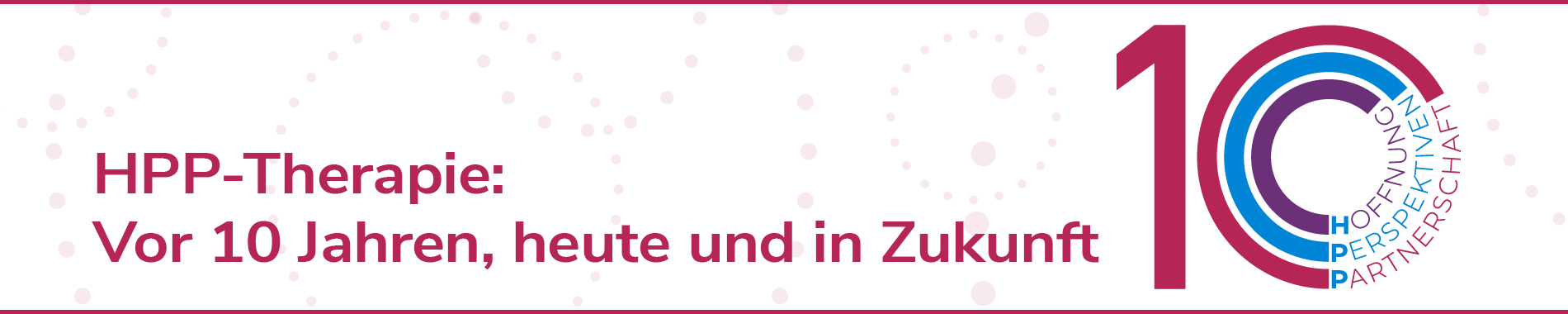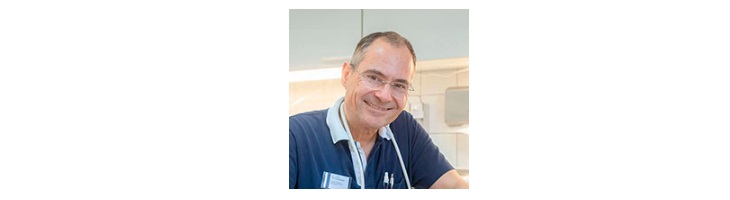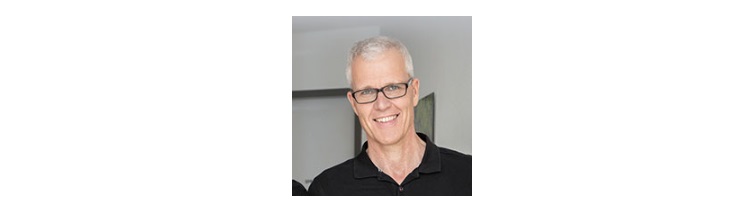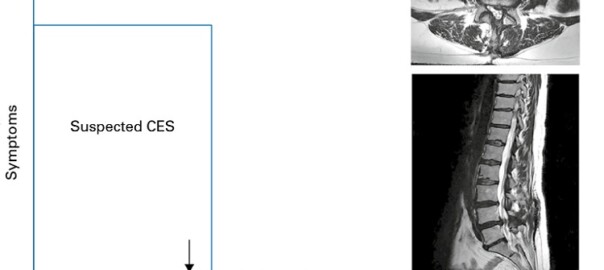Für die Evidenz der Maßnahmen werden die Kategorien IA bis IV der Kommission für Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen und in Einrichtungen und Unternehmen der Pflege und Eingliederungshilfe (KRINKO) 1 bzw. der CDC-Richtlinie, unterteilt nach Empfehlungsstärke / Evidenz2, zugrunde gelegt.
Aus Platzgründen wird nachfolgend anstelle der Erläuterung der Maßnahmen auf weiterführende Literatur verwiesen.
Auf der Grundlage der Beurteilung der individuellen Infektionsgefährdung empfohlene infektionspräventive Maßnahmen
Patientenbezogen sind folgende Entscheidungen zu treffen:
→ Durchführung der Operation (OP) in einem OP-Raum der Raumluftklasse Ib oder II
→ Screening auf multiresistente Erreger (MRE) (II)
→ Leitliniengerechte perioperative Antibiotikaprophylaxe (IA)
→ kontrollierte Normothermie (IA / hoch bis moderat)
→ Reduktion beeinflussbarer patienteneigener Risikofaktoren
Operationen mit geringem oder minimalem Infektionsrisiko können in einem Eingriffsraum, der nicht in eine OP-Abteilung integriert sein muss und keine raumlufttechnische Anlage benötigt, durchgeführt werden3 (Beispiele für die Orthopädie und Unfallchirurgie)4. Es ist keine Trennung in aseptische und septische OP-Räume erforderlich (II)5.
Vor elektiven Operationen ist zu beurteilen, ob im Fall der Wahrscheinlichkeit des Vorkommens eines MRE dieser aufgrund seines Kolonisationsstandorts postoperativ zu einer schwerwiegenden SSI führen kann. Das gilt insbesondere für Operationen mit indizierter PAP, weil in diesem Fall die PAP an das Antibiogramm des MRE angepasst werden kann. Ist aufgrund des Vorkommens eines MRE der OP-Erfolg gefährdet, ist ein auf Risikofaktoren beruhendes Screening (Details in 6 und 7)sinnvoll. International gibt es bisher nur Empfehlungen zum MRSA-Screening, bei denen MRSA ein unabhängiger Risikofaktor für eine SSI ist, um beim Nachweis präoperativ die antiseptische Dekolonisierung durchzuführen.8
Die PAP ist indiziert bei sauberen Operationen, sofern gleichzeitig patienteneigene Risikofaktoren und eine erhebliche Morbidität vorliegen oder alloplastische Implantate eingebracht werden sowie bei den Wundklassen „sauber-kontaminiert“, „kontaminiert“ oder „schmutzig“.(Details in 8 und 9 )
Patienten mit einer Anästhesiedauer >30 min sollen intraoperativ aktiv erwärmt werden; bei kürzerer Dauer ist das nur bei hohem Risiko einer perioperativen Hypothermie indiziert.(6 und 10)
Bei elektiven Eingriffen kann durch Verbesserung eines reduzierten Allgemeinzustands, z. B. aufgrund von Mangelernährung, durch prä- und postoperative zeitweilige Unterbrechung des Rauchens, Verzicht auf übermäßigen Alkoholgenuss, Bluttransfusion bei Anämie oder Gewichtsabnahme bei Adipositas das SSI-Risiko reduziert werden. Deshalb sollten im Rahmen der OP-Planung beeinflussbare Risikofaktoren identifiziert werden.11
Generell zutreffende infektionspräventive Maßnahmen
Präoperativ
Die Maßnahmen der Basishygiene beinhalten für das Team:
→ den Einsatz qualitätsgerecht aufbereiteter Medizinprodukte (IA / IV)
→ die hygienische Händedesinfektion (IA)
→ Hautschutz und Hautpflege (II / IV)
→ kein Tragen von Schmuck, Ringen, Uhren an Unterarmen und Händen (IB / IV), keine künstlichen Fingernägel (IB / IV) und kein Nagellack (II)
Fachspezifische Maßnahmen am Patienten beinhalten:
→ eine kurze präoperative Verweildauer (II)
→ die Sanierung bestehender Infektionen vor elektiven Eingriffen (II)
→ die präoperative universelle antiseptische Dekolonisation vor Implantation großer alloplastischer Implantate
→ bei Diabetes mellitus die Kontrolle des Glukosespiegels prä- und perioperativ (<200 mg/dl) (IA / hoch bis moderat)
→ die präoperative Körperreinigung des Patienten (III)
→ den Verzicht auf Rasur, falls Haarentfernung Clipping (IA)
Zur Prävention implantatassoziierter Infektionen durch Staphylococcus aureus und koagulase-negative Staphylokokken sollte eine Risikoanalyse durchgeführt und ggf. eine Dekolonisierungsstrategie entwickelt werden.3 Hierzu wird in 12 ein antiseptisches Konzept begründet.
Perioperativ
Die Maßnahmen der Basishygiene beinhalten für das Team:
→ das Betreten der OP-Einheit mit sauberen, desinfizierten Händen (IB)
→ das Tragen von Berufs-, Bereichs- und Schutzkleidung (II)
→ bei Gefahr der Durchfeuchtung wasserfester Schuhe (IV)
→ das Anlegen von Mund-Nasen-(MNS) und Haarschutz vor Betreten des OP, den Wechsel des MNS nach jeder OP, bei Durchfeuchtung oder Verschmutzung (IB)
→ das Anlegen einer Schutzbrille/-schild bei Kontaminationsgefahr durch Aerosole/Sekretspritzer
→ das Tragen medizinischer Einmalhandschuhe für nicht an der Operation beteiligte Springer
Fachspezifische Maßnahmen beinhalten für das Team peri- und intraoperativ:
→ die aseptische Disziplin im OP mit Wahrung der Aseptik auf dem Instrumentiertisch einschließlich des Verhinderns der ungeschützten Lagerung von Sterilgut außerhalb der Sterilverpackung (IB)
→ die Begrenzung der Personenanzahl und Bewegung im OP (II)
→ die chirurgische Händedesinfektion (IB)
→ das Tragen von OP-Handschuhen mit Double Gloving bei erhöhtem Perforationsrisiko (II)
Fachspezifische Maßnahmen am Patienten beinhalten:
→ die erregerdichte sterile OP-Abdeckung (IB)
→ keinen Einsatz nicht-antiseptischer Inzisionsfolie (IB) und keine Hautversiegelung (III)
→ die präoperative Hautantiseptik mit alkoholbasierten Mitteln (IA) mit remanenter Wirkung (IB)
Begonnen wird die präoperative Hautantiseptik mit leichtem Druck mittels Kornzange und Tupfer für 30 s mit anschließender Benetzung für die Dauer der Einwirkungszeit (Mittel der Wahl ist Betaseptic12).
Intraoperativ
Fachspezifische Maßnahmen beinhalten für das Team:
→ keinen Wechsel des Skalpells nach der Inzision
→ den Wechsel steriler Handschuhe vor Handhabung/Einbringen von Implantaten (IB)
Fachspezifische Maßnahmen am Patienten beinhalten:
→ den Einsatz von antiseptischem Nahtmaterial (II)
→ die antiseptische Wundspülung vor dem Wundverschluss (II / gering)
Aufgrund der wachsenden Studienzahl zur Elimination der in das OP-Feld gelangten residenten Hautflora durch antiseptische Spülung wächst die Evidenz zur Durchführung vor dem Einbringen alloplastischer Implantate. (Details in 2)
Postoperativ
Fachspezifische Maßnahmen beinhalten für das Team:
→ die fortlaufende Überprüfung des Qualitätsmanagements der Hygiene (IA / IV)
→ die Surveillance von SSI (IA / IV)
Fachspezifische Maßnahmen am Patienten beinhalten:
→ das aseptische Wundmanagement (II)
→ die sterile Wundabdeckung für 48 h (IB)
→ die strenge Indikation für Drainagen (II)
→ keine Antibiotikagabe nach OP-Ende (IA)
→ die Information von Patienten zu präventivem Verhalten (II)
Es ist wünschenswert, wenn Patienten das Pflegeteam zeitnah über Schmerzen im Bereich der Wundnaht oder im OP-Gebiet informieren. Gleiches gilt für das Auftreten von Diarrhöen, Anzeichen eines grippalen Infekts (Muskel-, Gelenk- und/oder Kopfschmerzen), erschwertes, schnelleres Atmen, atemabhängige Schmerzen sowie Fieber und Schüttelfrost als Hinweis auf eine Sepsis. Ferner sollte darauf hingewiesen werden, dass der Wundverband nicht eigenständig gelockert werden darf, um die Wunde sehen zu wollen. Durch ein Informationsblatt können die Patienten zur Mitarbeit gewonnen werden.
Für die Prävention von SSI hat es sich als effektiv erwiesen, besonders wichtige Maßnahmen zu einem Maßnahmenbündel zusammenzufassen, das Bündel zu trainieren und die Einhaltung z. B. mittels Checkliste zu überwachen.14 Allerdings sind trotz aller Bemühungen SSI aufgrund vor allem endogener Erregerquellen nicht komplett vermeidbar.
Durch die ständige Überprüfung der Hygienestandards, deren Evaluation und Anpassung ist die Prävention von SSI im erreichbaren Umfang zu gewährleisten. Deshalb fordert das Infektionsschutzgesetz für Krankenhäuser und Einrichtungen für ambulantes Operieren die Festlegung innerbetrieblicher Verfahrensweisen zur Infektionshygiene in Hygieneplänen und die Infektions-Surveillance zur Evaluierung der Präventionsmaßnahmen.
Im Modul OP-KISS können für die Einrichtung relevante Indikatoroperationen ausgewählt werden.
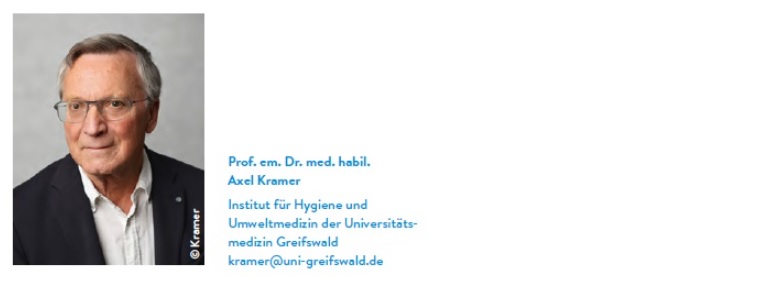
Weiterführende Quellen
- Die Kategorien in der Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention– Aktualisierung der Definitionen: Mitteilung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention. Bgbl. 2010; 53: 754–6.
- Berríos-Torres SI, Umscheid CA, Bratzler DW, et al. Surgical site infection (SSI) prevention guideline. JAMA 2017; 152(8):784-91.
- Hansis M, Kramer A, Mittelmeier W, et al. Prävention postoperativer Wundinfektionen. Empfehlung der KRINKO beim Robert Koch-Institut. Bgbl. 2018; 61:448–73.
- Kramer A, Wendt M, Assadian O, et al. Klinische und ambulante Operationszentren, Herzkatheterlabor und Hybrid-Operationseinheit. In: Kramer, A, Assadian O, Exner M, Hübner NO, Simon A, Scheithauer S (Hrsg) Krankenhaus- und Praxishygiene, 4. Aufl. Elsevier 2022 (bei nachfolgenden Quellen aus dem Buch als A bezeichnet); 668-82.
- Harnoss JC, Ojan O, Diener M, et al. Belastung in septischen und aseptischen Operationsräumen. Ergebnisse einer prospektiven, vergleichenden Beobachtungsstudie. Dtsch Arztebl Int. 2017; 114: 465-72.
- Kramer A, Harnoss JC, Kampf G. Grundlegende prä- und perioperative Voraussetzungen. In: A; 361-74.
- Bakterien (Teilkapitel mit unterschiedlichen Autoren). In: A; 222-48.
- Empfehlungen zur Prävention und Kontrolle von Methicillinresistenten Staphylococcus aureus-Stämmen (MRSA) in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen. Empfehlung der KRINKObeim Robert Koch-Institut. Bgbl. 2014; 57:696–732.
- Eckmann C, Maier S. Perioperative Antibiotikaprophylaxe. In: A; 84-6.
- NICE guideline. Surgical site infections: Prevention and treatment. 2020. https://www.nice.org.uk/guidance/ng125/resources/surgical-site-infections-prevention-and-treatment-pdf-66141660564421
- Stropnicky PV, Becker T, Pochhammer J, et al. Vermeidung postoperativer Wundinfektionen. Allg Viszeralchir. up2date 2023; 17: 301–20.
- Kramer A, Assadian O, Kampf G. Antiseptische Indikationen, Konzepte und Antiseptic Stewardship. In: A; 88-105.
- Dörfel D, Maiwald M, Daeschlein G, et al. Comparison of the antimicrobial efficacy of povidone-iodine-alcohol versus chlorhexidine-alcohol for surgical skin preparation on the aerobic and anaerobic skin flora of the shoulder region. Antimicrob Resist Infect Control 2021;10(1):17.
- Edminston CE, Leaper DJ. Prevention of orthopedic prosthetic infections using evidence-based surgical site infection care bundles: A narrative review. Surg Infect (Larchmt). 2022; 23(7):645-55.