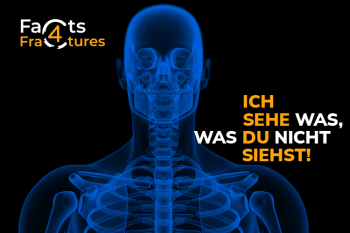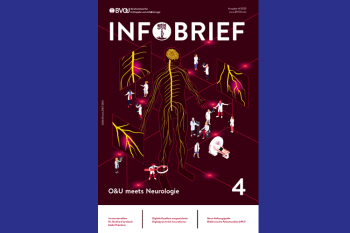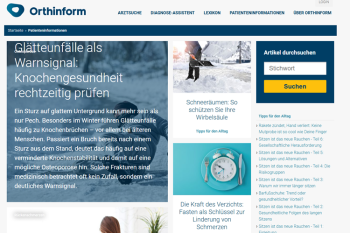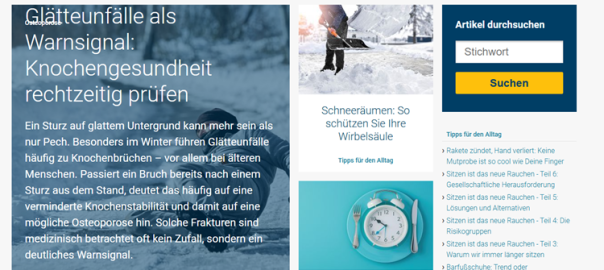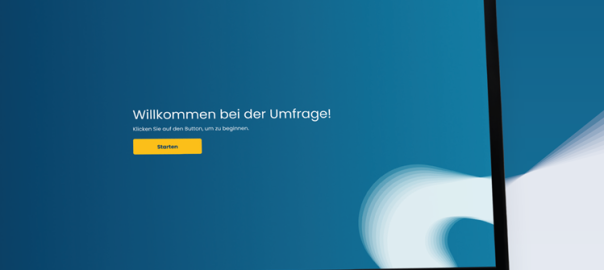Neuer GOÄ-Entwurf: Aktueller Stand und Engagement des BVOU
Die neue Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) ist jetzt öffentlich auf der Webseite der Bundesärztekammer zugänglich. Es handelt sich dabei um die Fassung, die bereits am 30. April 2025 den medizinischen Verbänden, Fachgesellschaften und den Delegierten des 129. Deutschen Ärztetags in Leipzig vorgelegt und dort mit großer Zustimmung angenommen wurde.
Entwicklung und rechtlicher Status
Der jetzt vorliegende GOÄ-Entwurf wurde in enger Abstimmung zwischen der Bundesärztekammer und dem PKV-Verband erarbeitet. Für operative Leistungen ist eine Abwertung im Vergleich zum ärzteeigenen GOÄ-Entwurf von 2023 festzustellen. Letztendlich ist die neue GOÄ eine hausarztzentrierte GOÄ, demzufolge sind Gesprächsleistungen und Koordinationsleistungen sehr attraktiv bewertet.
Aktuell ist diese Fassung noch nicht rechtsverbindlich. Das Bundesministerium für Gesundheit betont ausdrücklich, dass die Novellierung der GOÄ erst durch eine entsprechende Verordnung der Bundesregierung sowie Beschlüsse des Bundestags und Bundesrats in Kraft treten kann.
Für Ärztinnen und Ärzte stehen umfassende Erläuterungen zur neuen GOÄ bereit, um Fragen zu beantworten und das Verständnis für die geplanten Änderungen zu fördern. Dazu hat die Bundesärztekammer eine Seite mit Fragen & Antworten veröffentlicht.
Politische Weiterentwicklung
Nach dem klaren Votum des 129. Deutschen Ärztetags für die GOÄ-Reform – wobei ein grosser Teil der abstimmungsberechtigten Delegierten gar nicht über GOÄ abrechnet – wurde der Entwurf im Juni 2025 an Bundesgesundheitsministerin Nina Warken übergeben. Sie kündigte im Herbst 2025 an, einen Regelungsentwurf für Mitte 2026 vorzulegen. Bis zum Kabinettsbeschluss sind weitere Abstimmungen notwendig, anschließend folgt die Beratung im Bundestag und Bundesrat. Damit ist der lang erwartete Novellierungsprozess der GOÄ nun auch politisch offiziell angestoßen.
Stellungnahme des BVOU zum GOÄ-Entwurf:
Fachliche Beteiligung und kontinuierlicher Dialog
Der Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU) hat eigene fachliche Vorschläge in den Entstehungsprozess des GOÄ-Entwurfs eingebracht. Diese Vorschläge basieren auf den aktuellen medizinischen, technischen und versorgungsrelevanten Anforderungen der orthopädisch-unfallchirurgischen Praxis.
In einem Zwischenschritt wurde 2023 ein betriebswirtschaftlich kalkulierter Entwurf einer neuen GOÄ konsentiert, der vom BVOU mitgetragen wurde. Dieser Entwurf hat die anschließende Verhandlungsrunde mit der PKV jedoch nicht überstanden. Das war einer der Gründe, weshalb eine Reihe von Abgeordneten unter der Führung eines BVOU-Vertreters diesen GOÄ-Entwurf auf dem Ärztetag 2025 abgelehnt hatte.
Unabhängig davon ist der BVOU auch weiterhin über entsprechende Arbeitsgruppen im kontinuierlichen Dialog mit der Bundesärztekammer. Für die kommenden Monate sind eine Reihe von Terminen zu Einzelkapiteln vereinbart, die Vertreter des BVOU in Abstimmung mit Vertretern der Fachgesellschaften aktiv wahrnehmen werden. Ziel ist es, durch Änderungen am aktuellen Entwurf eine sachgerechte, praxisnahe und zukunftsfähige Ausgestaltung der Gebührenordnung zu erreichen.
Transparenz im weiteren Verfahren
Es ist wichtig zu betonen, dass der öffentlich zugängliche GOÄ-Entwurf keinen abschließenden Stand darstellt. Vielmehr handelt es sich um die Version, die dem Deutschen Ärztetag vorgestellt wurde.
Die inhaltliche Weiterentwicklung und redaktionelle Bearbeitung erfolgen weiterhin in enger Zusammenarbeit zwischen Bundesärztekammer, Berufsverbänden und dem Bundesgesundheitsministerium.
Der BVOU wird sich weiterhin mit Nachdruck für die Interessen seiner Mitglieder einsetzen und auf eine gerechte Vergütung für Orthopäden und Unfallchirurgen hinarbeiten wobei realistischer Weise nur einzelne grobe Fehler korrigiert werden können. Wir werden nach Abschluss der Gespräche über die Weiterentwicklung der GOÄ berichten.
Aktive Mitgestaltung durch den BVOU
Der BVOU begleitet diesen Reformprozess auch zukünftig aktiv und konstruktiv, um eine leistungsgerechte, transparente und zukunftsfähige Gebührenordnung für Orthopädinnen, Orthopäden und Unfallchirurginnen sowie Unfallchirurgen sicherzustellen.
Wir sind zuversichtlich, noch einige relevante Änderungen am aktuellen GOÄ-Entwurf einbringen zu können.
Schulungsangebote des BVOU
Sobald der Entwurf der neuen GOÄ einen absehbar finalisierten oder konsentierten Stand erreicht hat, werden wir unseren Mitgliedern GOÄ-Schulungen anbieten. Dort werden sowohl renommierte Experten als auch unsere Verhandlungsführer zu den Einzelkapiteln referieren.
Es ist unser Ziel, alle unsere Mitglieder vor Inkrafttreten der neuen GOÄ fit für deren Einsatz zu machen.
Ob die Einführung der neuen GOÄ bereits im Jahr 2027 erfolgen wird, ist momentan noch nicht absehbar. Wir gehen davon aus, dass sie sicher im Jahr 2028 in Kraft treten wird.
Dr. Johannes Flechtenmacher (Schatzmeister)
Dr. Jörg Ansorg ( Geschäftsführer)
Weitere Informationen
- Veröffentlichung des Entwurfs der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ)
https://www.bvou.net/veroeffentlichung-des-entwurfs-der-gebuehrenordnung-fuer-aerzte-goae/ - Entwicklung und Ausblick zur Novellierung der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) seit Herbst 2024
https://www.bvou.net/entwicklung-und-ausblick-zur-novellierung-der-gebuehrenordnung-fuer-aerzte-goae-seit-herbst-2024/