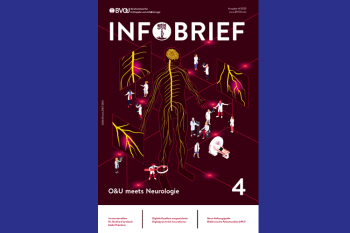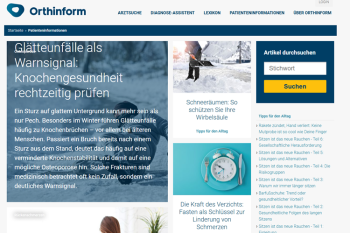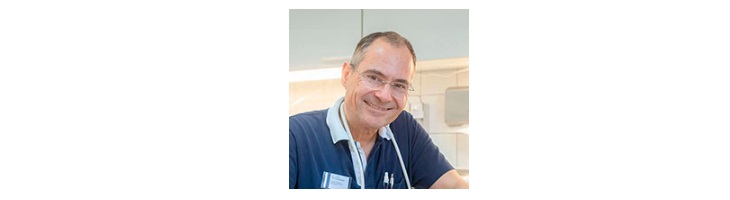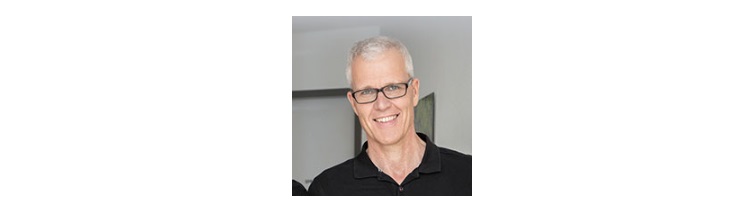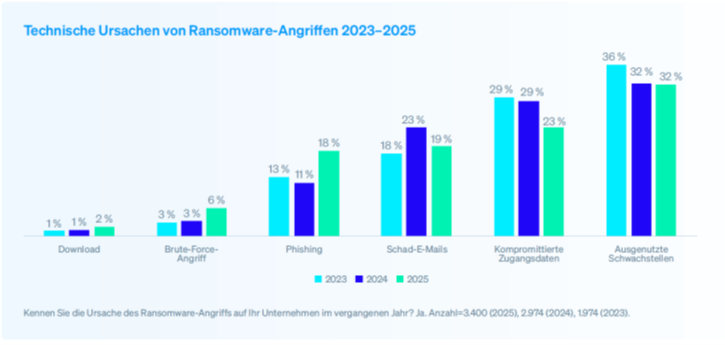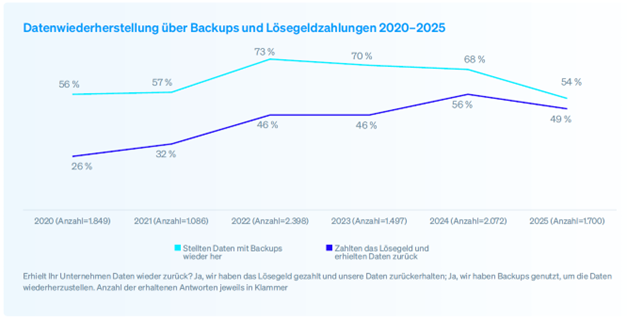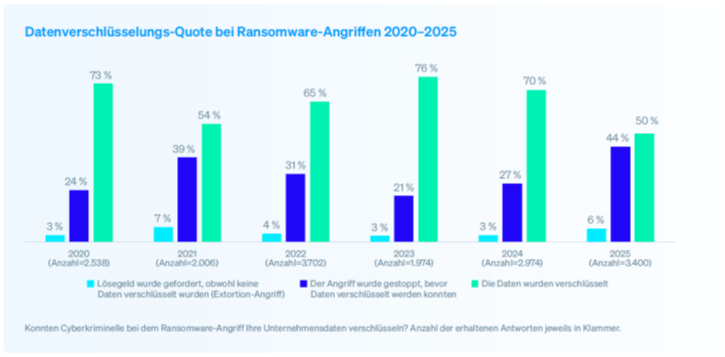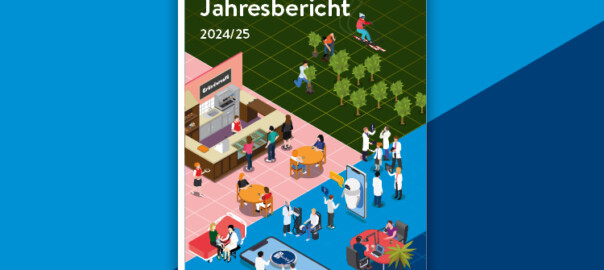Der Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU) e.V. nimmt die Veröffentlichung des IGeL-Monitors zum Anlass, die dort aufgestellten Behauptungen auf ihre wissenschaftliche Richtigkeit hin zu überprüfen und klarzustellen. So kann von einem erhöhten Risiko von Nebenwirkungen bei der Injektion von Hyaluronsäure keine Rede sein. (1)
Wissenschaftliche Grundlage
Der IGeL-Monitor gibt die oft komplexe und heterogene Studienlage zur Injektion von Hyaluronsäure verkürzt und einseitig wieder. So behauptet der Medizinische Dienst (MD), es gebe nur erhebliche Nebenwirkungen und keinen Nutzen. In der aktuellen S3-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) zeigt sich kein Unterschied in der Häufigkeit von Nebenwirkungen nach intraartikulärer Injektion von Hyaluronsäure im Vergleich zu Placebo. (2)
Weiterhin behauptet der MD, es gebe keinen Nachweis eines Nutzens.
Aufgrund eben dieses positiven Nutzennachweises gibt die aktuelle Leitlinie der OARSI (Osteoarthritis Research Society International) eine (bedingte) Empfehlung ab und empfiehlt sie als gegenüber der Injektion von Glucocorticoiden als die zu bevorzugende Alternative.
The use of intra-articular corticosteroids (IACS) and hyaluronan (IAHA) were conditionally recommended in individuals with knee OA in all groups. A Good Clinical Practice Statement applying to intra-articular (IA) treatments for all comorbidity subgroups was added, noting that intra-articular corticosteroid (IACS) may provide short term pain relief, whereas Intra-articular hyaluronic acid (IAHA) may have beneficial effects on pain at and beyond 12 weeks of treatment and a more favorable long-term safety profile than repeated IACS. (3)
Eine positive Empfehlung existiert auch für die Injektion von Glucocorticoiden in der S3-Leitlinie der DGOU, ebenso für die Injektion von plättchenreichem Plasma (PRP) (auch Selbstzahlerleistung).
Für die intraartikuläre Hyaluronsäure-Injektion kam deshalb keine Empfehlung zustande, da die Evidenzlage in den Studien zu widersprüchlich ist, um eine eindeutige Empfehlung abzuleiten. Diese – zugegeben komplexen – wissenschaftlichen Grundlagen bei der intraartikulären Therapie der Gonarthrose werden vom IGeL-Monitor nicht oder nur verzerrt bzw. falsch wiedergegeben.
Einsatz von Therapien und ihre Evidenz
Die wissenschaftlichen Empfehlungen der Fachgesellschaften bilden die Basis der Behandlung in Orthopädie und Unfallchirurgie. Diese als Leitlinien bezeichneten Empfehlungen stützen sich auf die Auswertung von Studien und Expertenmeinungen. Die Empfehlungsgrade variieren je nach Studienlage zwischen „stark empfohlen“ und „nicht empfohlen“.
Bei vielen gängigen konservativen Therapien (z.B. physikalische Therapien) fehlen oft die Studien bzw. sind diese zu heterogen, um eine Empfehlung überhaupt auszusprechen oder die Empfehlungsgrade sind schwach bis neutral. Einige dieser Therapien, die von den Kassen erstattet werden, sind, anders als die intraartikulären Injektionen, sogar mit einem negativen Empfehlungsgrad versehen (Orthesen, Tapes, transkutane elektrische Nervenstimulation – TENS, Ultraschalltherapie, Lasertherapie).
So stehen in vielen Fällen die Ärztinnen und Ärzte vor dem Dilemma, dass neben Beratung und Patientenedukation vor der Operation nicht allzu viele Therapieoptionen bereitstehen, für die es eine uneingeschränkte Empfehlung auf Basis der Studienlage gibt.
Dagegen erwarten Patientinnen und Patienten zu Recht von ihren behandelnden Ärztinnen und Ärzten, dass sie vieles vor der Operation ausschöpfen, auch wenn die Evidenz für diese konservativen Therapien schwach ist.
Dies gilt insbesondere bei chronischen Beschwerden wie Arthrose oder Sehnenreizungen, wenn Standardtherapien ausgeschöpft sind. Wir halten dieses Vorgehen für gerechtfertigt, da es nach unserer Erfahrung zu besseren Ergebnissen und einer höheren Zufriedenheit unserer Patientinnen und Patienten führt.
Differenzierte Bewertung von Selbstzahlerleistungen
Es fällt in der aktuellen Diskussion auf, dass ärztliche Leistungen, sobald sie als Selbstzahlerleistungen angeboten werden, häufig pauschal als kommerziell motivierte Überversorgung oder „unseriöse Zusatzleistung“ eingeordnet werden, während dieselbe Behandlung im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung als „anerkannte medizinische Therapie“ gilt.
Dabei existieren für viele Therapien und Verordnungen, die die Kassen ganz oder zumindest teilweise erstatten, keine gesicherten Studien und damit kein Nachweis von Wirksamkeit. Dies gilt für einige Hilfsmittel und physikalische Therapien, aber auch für Physiotherapie bei bestimmten Krankheitsfällen. In all diesen Fällen gibt es keinen überzeugenden Evidenznachweis.
Erinnert sei auch an homöopathische Leistungen, die von vielen Krankenkassen übernommen werden, die aber jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehren. Einige Therapien, wie z. B. die Stoßwellentherapie (ESWT) bei Plantarfasziitis, waren einst als IGeL gebrandmarkt, sind jetzt aber in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherungen aufgenommen worden.
Fazit:
Patientinnen und Patienten sollten sich bei der Auswahl ihrer Therapien auf die Leitlinien der wissenschaftlichen Fachgesellschaften und die Empfehlungen der Ärztinnen und Ärzte verlassen, aber nicht auf die Erstattungspraxis der Kassen und die Publikationen des Medizinischen Dienstes – beide genügen wissenschaftlichen Kriterien nicht.
Der IGeL-Monitor gibt sich den Anstrich einer wissenschaftlichen Analyse zu medizinischen Therapien. In Wahrheit handelt es sich hier um einen Beitrag zum „Ärzte-Bashing“. Eine differenzierte und für die Versicherten hilfreiche Bewertung von Therapien findet hier nicht statt. Der BVOU fordert eine Klarstellung.
Über den BVOU:
Der Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. (BVOU) ist die berufspolitische Vertretung für mehr als 7.500 in Praxis und Klinik tätige Kolleginnen und Kollegen. Der BVOU setzt die beruflichen Interessen seiner Mitglieder durch, indem er zum Vorteil der Patienten und des Gemeinwohls gemeinsam mit den wissenschaftlichen Gesellschaften den Standard orthopädisch-unfallchirurgischer Versorgung entwickelt, die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen prägt und dadurch die öffentliche Wahrnehmung seiner Mitglieder als Experten für orthopädisch-unfallchirurgische Versorgung gestaltet.
Pressekontakt:
Janosch Kuno
Straße des 17. Juni 106-108
10623 Berlin
presse@bvou.net
2 https://register.awmf.org/assets/guidelines/187-050l_S3_Gonarthrose_2025-05.pdf, Seite 108
3 https://www.oarsijournal.com/article/S1063-4584(19)31116-1/fulltext, Seite 1583