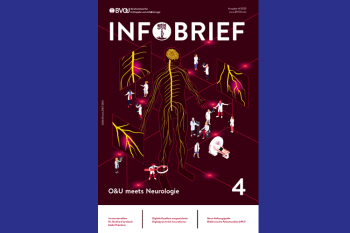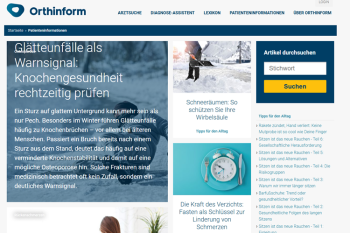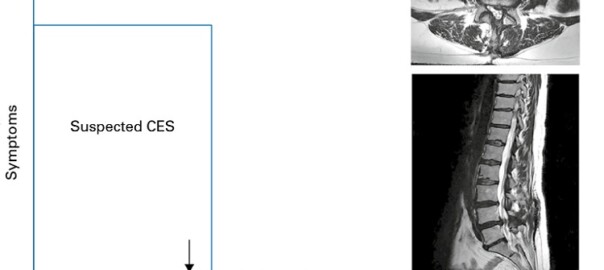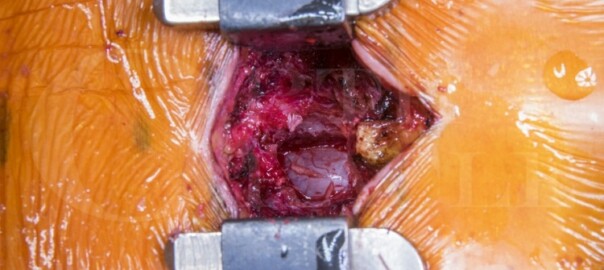Dieser Beitrag soll einen kurzen Überblick aus juristischer Sicht über die Anforderungen von Aufklärung und Einwilligung zu einer ärztlichen Maßnahme bei einwilligungsunfähigen Patienten (1) geben.
1. Einwilligungsfähigkeit/-unfähigkeit; Grundsätze für Aufklärung und Einwilligung
Einwilligungsfähigkeit darf nicht gleichgesetzt werden mit Geschäftsfähigkeit.
Einwilligungsfähig ist, wer die natürliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit besitzt, um Art, Notwendigkeit, Bedeutung, Folgen und Risiken der medizinischen Maßnahme zu verstehen und die Tragweite seiner Entscheidung zu überblicken (2). Der Patient muss also nach seiner geistigen und sittlichen Reife die Tragweite der Maßnahme erfassen und seinen Willen hiernach ausrichten können. Besitzt ein Patient zum maßgeblichen Zeitpunkt der Einholung der Einwilligung vor Durchführung der Maßnahme nicht diese natürliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit, so ist er einwilligungsunfähig.
Die Frage, ob ein Patient einwilligungsfähig oder einwilligungsunfähig ist, ist somit stets und ausschließlich aus medizinischer Sicht im konkreten Einzelfall durch den behandelnden Arzt zu entscheiden. Das Alter der Patienten spielt zwar eine wichtige, aber nicht allein entscheidende Rolle (3).
Bei medizinischen Maßnahmen gegenüber einwilligungsunfähigen Patienten ist nach § 630 d Abs. 1 S. 2 BGB die Einwilligung eines hierzu Berechtigten einzuholen, soweit nicht der Patient selbst noch im einwilligungsfähigen Zustand durch eine wirksame und einschlägige Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht die Maßnahme gestattet oder untersagt hat. In diesem Fall muss der Patient aber noch im einwilligungsfähigen Zustand über die Maßnahme aufgeklärt worden sein, damit durch die Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht wirksam die Einwilligung erteilt bzw. abgelehnt werden kann (4).
Als Berechtigte kommen der gesetzliche Vertreter (z. B. Eltern, Vormund des Minderjährigen, bestellter Betreuer bei Volljährigen, Ehegatte/eingetragener Lebenspartner im Falle des Ehegattennotvertretungsrechts) oder der rechtsgeschäftlich Bevollmächtigte (z. B. Vorsorgebevollmächtigter) in Betracht.
Im Fall eines gerichtlich bestellten Vormunds (bei Minderjährigen), Betreuers (bei Erwachsenen) oder eines Vorsorgebevollmächtigten muss sich der Arzt vorab vergewissern, ob diesem die Gesundheitssorge als Teil seines Aufgabenkreises übertragen wurde, da nur dann zum einen die Zuständigkeit für die Einwilligung gegeben ist und zum anderen im Hinblick auf die ärztliche Schweigepflicht die Offenbarung gegenüber diesen Personen zulässig ist.
Dementsprechend bestimmt § 630e Abs. 4 BGB, dass im Falle eines einwilligungsunfähigen Patienten die Aufklärung auch gegenüber dem gesetzlichen Vertreter oder Bevollmächtigten zu erfolgen hat. Jedoch ist gemäß § 630e Abs. 5 BGB zusätzlich der einwilligungsunfähige Patient grundsätzlich über die wesentlichen Umstände der Maßnahme entsprechend seinem Verständnis zu informieren, soweit dieser aufgrund seines Entwicklungsstandes und seiner Verständnismöglichkeiten in der Lage ist, die Erläuterungen aufzunehmen und soweit dies seinem Wohl nicht zuwiderläuft. Bei Patienten im Koma oder bei Säuglingen kann demnach offenkundig von einer Erläuterung abgesehen werden (5).
2. Volljährige Patienten
Bei einem Volljährigen ist grundsätzlich von dessen Einwilligungsfähigkeit auszugehen. An die Feststellung der Einwilligungsunfähigkeit sind hohe Anforderungen zu stellen. Der Arzt hat hierbei sämtliche Umstände wie Alter, physische und psychische Konstitution, Einfluss von Medikamenten, Grad der Verständnisfähigkeit, Bildungsgrad, Vorkenntnisse, Herkunft, kulturelle Tradition u.a. zu berücksichtigen. Bei Zweifeln muss konsiliarisch ein Neurologe und/oder Psychiater hinzugezogen werden (6).
Bei dementen, verwirrten, drogenabhängigen oder alkoholisierten Patienten, infolge eines Unfallschocks oder erheblicher Schmerzen kann – muss aber nicht zwangsläufig – eine Einwilligungsunfähigkeit vorliegen. Eine angeordnete Betreuung, selbst wenn sie den Aufgabenkreis der medizinischen Versorgung umfasst, bedeutet ebenfalls nicht automatisch, dass der Patient einwilligungsunfähig ist.
Fehlt in diesen Fällen jedoch die Einwilligungsfähigkeit, so können – soweit nicht eine wirksame und einschlägige Patientenverfügung nach § 1827 Abs. 1 S. 1 die Maßnahme gestattet oder untersagt – nur ein gerichtlich bestellter Betreuer, ein Vorsorgebevollmächtigter oder bei Vorliegen der Voraussetzungen des Ehegattennotvertretungsrechts der Ehegatte/eingetragene Lebenspartner in eine Behandlungsmaßnahme einwilligen und es sind auch diese Aufklärungsadressat (§ 630d Abs. 1 S. 2, Abs. 2 i. V. m. § 1827 Abs. 2, 6, § 1358 BGB).
Bei begründeter Gefahr des Versterbens oder eines schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schadens erfordert die Entscheidung der vorgenannten Berechtigten grundsätzlich zusätzlich die Genehmigung durch das Betreuungsgericht (§ 1829 Abs. 1, 2 BGB). Besteht zwischen dem Berechtigten und dem behandelnden Arzt Einvernehmen darüber, dass die getroffene Entscheidung dem nach § 1827 BGB festgestellten Willen des Patienten entspricht, entfällt das Genehmigungserfordernis (§ 1829 Abs. 4 BGB). Aus juristischer Sicht ist die Dokumentation der diesbezüglichen Tatsachen und das Einvernehmen zwingend zu empfehlen.
Liegt Einwilligungsunfähigkeit vor, fehlt eine Patientenverfügung oder ist diese nicht einschlägig bzw. nicht eindeutig und ist kein Berechtigter vorhanden, so hat der Arzt beim Betreuungsgericht die Anordnung einer Betreuung anzuregen.
Handelt es sich in dieser Situation um einen Notfall (Vornahme ärztlicher Maßnahmen ist vital indiziert und unaufschiebbar), so sind in den Fällen, in denen die Bestellung, die Aufklärung und Einwilligung eines Berechtigten oder die entsprechende Eilentscheidung des Betreuungsgerichts nach § 1867 BGB nicht mehr rechtzeitig möglich ist, die gebotenen Maßnahmen durchzuführen. Das Handeln des Arztes kann durch die Rechtfertigungsgründe der mutmaßlichen Einwilligung gemäß § 630d Abs. 1 S. 4 BGB und/oder des Notstands gemäß § 34 StGB gedeckt werden (7). Der Arzt muss, sofern die Zeit ausreicht, zunächst den mutmaßlichen Patientenwillen durch frühere Äußerungen des Patienten, Befragungen von nahen Angehörigen oder Bezugspersonen etc. ermitteln. Fehlen entgegenstehende Anhaltspunkte, kann jedoch angenommen werden, dass der Patient wie ein verständiger Patient in der konkreten Lage handeln würde, wenn die Behandlung fehlerfrei ist (8). Kann ein entsprechender Wille des Patienten nicht ermittelt werden und bleiben erhebliche Zweifel an dem Bestehen oder Fortbestehen eines vorherigen Willens, so gilt der Grundsatz: In dubio pro vita (9).
Seit 01.01.2023 kommt bei verheirateten oder in eingetragener Lebenspartnerschaft lebenden einwilligungsunfähigen Patienten gemäß § 1358 BGB das sog. Ehegattennotvertretungsrecht in Betracht. Dieses greift nach Absatz 1, wenn ein Ehegatte aufgrund von Bewusstlosigkeit oder Krankheit seine Angelegenheiten der Gesundheitssorge rechtlich nicht besorgen kann. Dann ist der andere Ehegatte berechtigt, für den vertretenen Ehegatten u. a. in Untersuchungen des Gesundheitszustandes, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einzuwilligen oder sie zu untersagen sowie ärztliche Aufklärungen entgegenzunehmen oder Behandlungsverträge, Krankenhausverträge oder Verträge über eilige Maßnahmen der Rehabilitation und der Pflege abzuschließen und durchzusetzen. Dieses neue Vertretungsrecht sowie die in Absatz 2 geregelte Offenbarungsbefugnis gegenüber dem vertretenden Ehegatten bestehen gemäß § 1358 Abs. 3, 5 BGB jedoch nicht, wenn
- die Ehegatten getrennt leben,
- ein Betreuer bestellt ist bzw. ab dem Zeitpunkt der Betreuerbestellung, soweit dessen Aufgabenkreis diese Angelegenheiten umfasst,
- dem vertretenden Ehegatten oder dem behandelnden Arzt bekannt ist, dass der vertretene Ehegatte
- a) eine Vertretung durch den anderen Ehegatten ablehnt oder
- b) einen Vorsorgebevollmächtigten bestellt hat, soweit diese Vollmacht diese Angelegenheiten umfasst
- die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht mehr vorliegen oder
- mehr als 6 Monate seit dem durch den Arzt festgestellten Zeitpunkt, zu dem die Voraussetzungen des Absatzes 1 spätestens eingetreten sind, vergangen sind.
Die Vorschriften des Betreuungsrechts gelten für die Wahrnehmung des Ehegattennotvertretungsrechts entsprechend (§ 1358 Abs. 6 BGB).
3. Besonderheiten bei minderjährigen Patienten
Maßgeblich ist, ob der Minderjährige einsichts- und urteilsfähig ist. Ist dies gegeben, so kommt dem minderjährigen Patienten grundsätzlich auch die alleinige Einwilligungsbefugnis zu und er ist Aufklärungsadressat. An die Feststellung der Einwilligungsfähigkeit des Minderjährigen sind jedoch hohe Anforderungen zu stellen.
Feste Altersgrenzen oder pauschale Aussagen zur Einwilligungsfähigkeit verbieten sich. Jedoch besteht aus juristischer Sicht weitestgehend Einigkeit, dass bei unter 14-Jährigen die Einwilligungsfähigkeit grundsätzlich abzulehnen ist.
Je näher ein Patient über 14 Jahren an der Volljährigkeit ist, desto eher wird dessen Einwilligungsfähigkeit vorliegen können. Nach der Rechtsprechung dürfte in der Regel bei Vollendung des 16. Lebensjahres Einwilligungsfähigkeit anzunehmen sein, eine ernsthafte Prüfung ist jedoch gleichwohl in jedem Einzelfall erforderlich (10).
Ist ein minderjähriger Patient aber ausreichend urteilsfähig, so steht ihm nach höchstrichterlicher Rechtsprechung auch bei einem nur relativ indizierten Eingriff mit der Möglichkeit erheblicher Folgen für seine künftige Lebensgestaltung (z. B. Querschnittlähmung) ein Vetorecht gegen die Fremdbestimmung durch die gesetzlichen Vertreter zu. Der BGH geht bei einem 15-jährigen Schüler regelmäßig von dessen Urteilsfähigkeit aus. Damit der minderjährige Patient von seinem Vetorecht Gebrauch machen
kann, ist er ebenfalls entsprechend aufzuklären, wobei der Arzt allerdings im Allgemeinen darauf vertrauen kann, dass die Aufklärung und Einwilligung der Eltern genügt (11).
Bei einwilligungsunfähigen Minderjährigen müssen, wenn beide Eltern gemeinsam sorgeberechtigt sind, grundsätzlich auch beide Eltern aufgeklärt werden und einwilligen. Zudem ist die Erläuterungspflicht des § 630d Abs. 5 BGB bei einwilligungsunfähigen Minderjährigen zu beachten. Folglich muss stets nach dem Sorgerecht gefragt werden, denn dies kann auch bei geschiedenen oder getrenntlebenden Eltern gemeinsam bestehen. Die Eltern können sich aber gegenseitig die Ermächtigung erteilen, auch für den anderen Elternteil zu entscheiden.
Der BGH hat für die Pflichten des Arztes zur Feststellung der Aufklärungsadressaten und Einwilligungsbefugten im Hinblick auf einen oder beide Elternteile folgende Grundsätze aufgestellt (12):
- Bei alltäglichen, geringfügigen Routinemaßnahmen darf der Arzt regelmäßig auf eine derartige wechselseitige Ermächtigung vertrauen, wenn ein Elternteil mit dem Kind zur Behandlung erscheint oder es anmeldet, solange ihm keine entgegenstehenden Anhaltspunkte bekannt sind.
- Bei erheblicheren Maßnahmen mit nicht unbedeutenden Risiken hat der Arzt darüber hinaus eine Fragepflicht, d. h. er muss beim erschienenen Elternteil bezüglich der Ermächtigung zur Einwilligung nachfragen und wie weit diese reicht, darf dann aber auf dessen wahrheitsgemäße Auskunft vertrauen, solange keine Anhaltspunkte dem entgegenstehen. Darüber hinaus kann es angebracht sein, auf den erschienenen Elternteil dahin einzuwirken, die vorgesehenen ärztlichen Eingriffe und deren Chancen und Risiken noch einmal mit dem anderen Elternteil zu besprechen.
- Lediglich bei schweren Maßnahmen mit erheblichen Risiken für die Lebensführung des Kindes muss sich der Arzt die Gewissheit verschaffen, dass der nicht erschienene Elternteil mit der vorgesehenen Behandlung des Kindes einverstanden ist, sodass auch der nicht erschienene Elternteil aufgeklärt und dessen Einwilligung eingeholt werden muss.
Eine telefonische Aufklärung und Einholung einer Einwilligung eines Elternteils reicht aus Sicht des BGH nur aus bei einfach gelagerten Fällen. Sofern es sich dagegen um komplizierte Maßnahmen mit erheblichen Risiken handelt, wird eine telefonische Aufklärung regelmäßig unzureichend sein (13). Ob ein einfach gelagerter oder ein komplizierterer Fall vorliegt, ist letztendlich eine ausschließlich medizinisch zu beantwortende Frage. In Eil- oder Notfällen genügt jedoch grundsätzlich die Einwilligung des erreichbaren Elternteils (14).
Wurde den Eltern das Sorgerecht ganz oder teilweise für den Bereich der Gesundheitssorge entzogen, so ist das Sorgerecht für den einwilligungsunfähigen Minderjährigen regelmäßig einem gerichtlich bestellten Vormund übertragen, der dann anstelle der Eltern als gesetzlicher Vertreter des Minderjährigen aufzuklären und einwilligungsbefugt ist.
Dr. jur. Jörg Heberer
Justitiar BVOU, Berlin
Fachanwalt für Medizinrecht, München
1 Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Artikel das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten immer für alle Geschlechter
Quellenangaben:
2 Grüneberg/Weidenkaff, Bürgerliches Gesetzbuch, 82. Aufl. 2023, C. H. Beck, § 630d Rn. 3
3 OLG Hamm, Beschluss vom 29.11.2019 – II-12 UF 236/19
4 Grüneberg/Weidenkaff, a. a. O., § 630d Rn. 3
5 Grüneberg/Weidenkaff, a. a. O., § 630e Rn. 9
6 Biermann in: Ulsenheimer/Gaede, Arztstrafrecht in der Praxis, 6. Aufl. 2020, aa) Die natürliche Einsichtsfähigkeit als Voraussetzung wirksamer Einwilligung, Rn. 435
7 Biermann, a. a. O., cc) Einwilligungsunfähige Volljährige, Rn. 453
8 Grüneberg/Weidenkaff, a. a. O., § 630d Rn. 4
9 LG Saarbrücken, Urteil vom 03.06.2024 – 4 O 308/22; Biermann, a. a. O., Rn. 453
10 OLG Hamm, Beschluss vom 29.11.2019 – II-12 UF 236/19
11 BGH, Urteil vom 10.10.2006 – VI ZR 74/05
12 BGH, Urteil vom 15.06.2010 – VI ZR 204/09
12 BGH, Urteil vom 15.06.2010 – VI ZR 204/09
14 vgl. zu Ziffer 3 insgesamt: Heberer Jörg, Rechtliche und Medizinische Aspekte der gynäkologischen Aufklärung, Frauenheilkunde up2date 2022; 16 (6): 1-18, Thieme