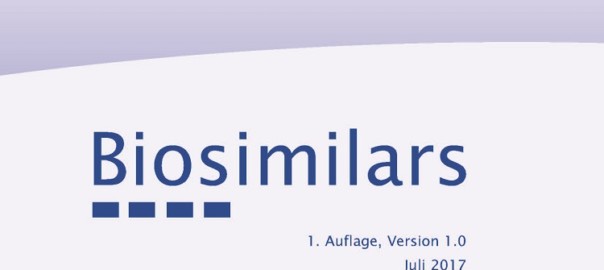Kassel – Unterdurchschnittlich abrechnende Praxen haben einen Anspruch darauf, nicht durch Regelungen der Honorarverteilung an einem Wachstum bis zum Durchschnitt ihrer Facharztgruppe gehindert zu werden. Anfängerpraxen dürfen sich bis zu fünf Jahre Zeit lassen, um diesen Facharztgruppendurchschnitt zu erreichen. Wer aber auf Dauer das Regelleistungsvolumen (RLV) seiner Arztgruppe nicht erreicht, weil er nur wenige Patienten behandelt, kann – von Härtefallregelungen abgesehen – von seiner Kassenärztlichen Vereinigung (KV) keine dauerhafte Honorarstützung einfordern. Dies sei mit dem Gesichtspunkt der Honorargerechtigkeit nicht zu vereinbaren. Das hat das Bundessozialgericht (BSG) vor kurzem in mehreren Verfahren entschieden.
Geklagt hatten mehrere Urologen; ihre Einwände bezogen sich auf die Honorarregelungen verschiedener Jahre. In einem Fall hatte das Bundessozialgericht klargestellt, dass eine nachträgliche Absenkung des RLV im Quartal IV/2009 nicht zulässig war. In einem anderen machte das BSG aber deutlich, dass das Argument, die Praxis habe die Fallzahl nicht deutlich steigern können, weil der eigene Bezirk stark überversorgt sei, nicht gelte. Dieser Konstellation müsse die KV nicht „im Rahmen der Honorarverteilung durch die Zuweisung eines – für alle unterdurchschnittlichen Praxen erhöhten – Punktzahlvolumens – Rechnung tragen“. Dass die Erhöhung des Honorars von Fallzahlsteigerungen abhängig gemacht werde, sei nicht zu beanstanden.
Quelle: Pressestelle BSG