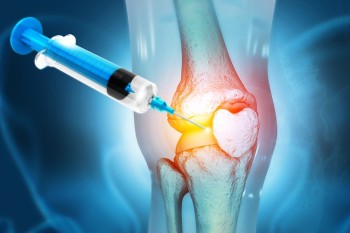Die präoperative – und perioperative – Vor-Diagnostik und Überwachung hat national wie international zunehmend Aufmerksamkeit bekommen und die publizierten Empfehlungen haben hohe Evidenzstärken.
2024 erschienen für Deutschland – in zweiter Überarbeitung nach 2010 und 2017 – die aktuellen Empfehlungen der wissenschaftlichen Fachgesellschaften für Anästhesie, Chirurgie und Innere Medizin zur perioperativen Evaluation.1 Diese Empfehlungen werden in diesem Artikel eingangs kurz referiert. Zudem werden Besonderheiten, die für Raucher sowie Alkohol- und Substanzgewöhnte bekannt sind und beachtet werden sollten, besprochen.
Allgemeine Empfehlungen zum perioperativen Vorgehen (2024)
Die Planungssicherheit für eine risikoarme2 OP und Narkose hängt ab von:
a) dem eingriffsbezogenen Risiko (i.W. Eingriffstyp und -Lokalisation)
b) dem patientenbezogenen Risiko, speziell abhängig vom Alter und dem Vorliegen von kardiovaskulären Risikofaktoren3, inkl. der Abfrage der individuellen Belastbarkeit4 und einer strukturierten Gerinnungsanamnese.
Die o. g. Informationen sind i. a. R. in einer Anamnese abfragbar. Spezielle körperliche Untersuchungen oder Daten sind zunächst einmal nicht erforderlich, jedoch eine Inspektion des geplanten OP-Bereichs und der Atemwege. Empfohlen wird eine Auskultation von Herz und Lunge. Pragmatisch (aber gestützt durch entsprechende Daten und internationale Empfehlungen) fordern die o. g. Empfehlungen noch:
→ Alter > 45 Jahre: 12-Kanal-EKG
→ Alter > 65 Jahre: Bestimmung des Serum-Kreatinins und des Hämoglobins
→ immer: eine Messung der peripheren Sauerstoffsättigung (Risiko ab ≤ 95 %)
Die Nutzung von einfachen Scoresystemen zur Erfassung des Risikos für ein postoperatives Delir und für pulmonale Komplikationen wird empfohlen.
Labor: zusätzlich zu o. g. nur bei gezielter (Organ-)spezifischer Diagnostik oder zur Funktionskontrolle (z. B. Antikoagulation). Eine routinemäßige Erhebung von Laboruntersuchungen („Screening“) soll nicht durchgeführt werden.
Weiterführende Diagnostik: Routinemäßige Thoraxröntgen-Aufnahmen („Screening“) können nicht empfohlen werden. Weitere Diagnostik erfordert valide Anhaltspunkte und Fragestellungen.
Umgang mit präoperativ etablierter Vor-Medikation:
Kritisch wird das Absetzen von anti-Parkinson-Mitteln und Psychopharmaka gesehen, aber auch die präoperative Therapie mit β-Rezeptorantagonisten soll weitergeführt werden. Bei Patienten, bei denen eine Statintherapie besteht, soll diese Therapie ebenfalls perioperativ fortgesetzt werden.
Umgang mit Rauchern, Alkoholkranken und Drogenabhängigen:
Generell sollte bei (kritischer) Substanzabhängigkeit (und dringlicher OP) zur Risikoreduktion perioperativ der Substanzkonsum nach Möglichkeit fortgesetzt (z. B. Alkohol, Nikotin) oder substituiert (z. B. Opioide) werden, um perioperative Unruhe, Entzugssymptome und lebensbedrohliche vegetative Entgleisungen zu vermeiden.
Definition von Rauchen, Alkohol- und Drogennutzung:
Unter regelmäßigem Rauchen wird tägliches Rauchen verstanden, auch wenn es sich um geringe Tabakmengen handelt. Als starker Raucher wird entsprechend den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein Raucher mit einem täglichen Zigarettenkonsum von mehr als 20 Stück bezeichnet.
Alkoholgewöhnung ist schwer zu definieren: Einen riskanten Konsum von Alkohol mit potenziellen schädlichen Folgen für die Gesundheit definiert die WHO, wenn Frauen täglich mehr als 12 g Alkohol – also etwa ein Glas Sekt – zu sich nehmen. Bei Männern sind es 24 g – also mehr als ein halber Liter Bier. Alkoholabhängigkeit oder -Sucht (Alkoholkrankheit ICD-10) ist per Definition gegeben, wenn drei der folgenden Kriterien über 1 Monat erfüllt sind: starkes oder zwanghaftes Verlangen, Alkohol zu konsumieren; verminderte Kontrollfähigkeit bei der Menge, dem Beginn oder Ende des Konsums; körperliche Entzugserscheinungen; Nachweis einer Toleranz; Einengung des Denkens auf Alkohol; anhaltender Substanzkonsum trotz gesundheitlicher und sozialer Folgeschäden.
Marker für chronischen Alkoholkonsum sind:
→ Phosphatidylethanol (PEth)
→ kohlenhydratdefizientes Transferrin (CDT)
→ mittleres korpuskuläres Volumen der Erythrozyten (MCV)
→ γ-Glutamyltransferase (γ-GT)
Cave: Diese Labormarker können zwar einen erhöhten Alkoholkonsum des Patienten aufdecken, nicht aber eine Abhängigkeit des Patienten nachweisen.
Drogenkonsum bezeichnet jede Art der Anwendung von psychotropen Substanzen (Drogen), wobei die Drogen einzeln und völlig unterschiedlich zu bewerten sind. Ein hochriskanter Cannabiskonsum liegt z. B. nach aktuellen Studien5 bei einem Konsummuster vor, das folgende Merkmale aufweist:
→ Mehr als 4 Joints pro Woche bei etwa 0,25 g Cannabis im Joint
→ Cannabis mit einem Wirkstoffgehalt von mehr als 10 % THC
→ gleichzeitiger Konsum von Cannabis mit Alkohol oder anderen Drogen
Für bestimmte Personengruppen ist jeglicher Konsum als hochriskant einzuschätzen:
→ Junge Menschen unter 21 Jahren
→ Frauen, die schwanger sind oder stillen
→ Menschen mit psychischen Problemen oder anderen psychotischen Störungen
→ Personen mit bestimmten organischen Erkrankungen wie COPD und anderen
→ Professionell Tätige, die ein Fahrzeug fahren oder schwere Maschinen bedienen
Pragmatisches Vorgehen bei den genannten Risikogruppen
Raucher:6
Ein Rauchstopp kann selbst kurz vor einer Operation zumindest noch die Sauerstoffmenge im Körper erhöhen. Schon nach 24 Stunden ohne Zigaretten werden Nikotin und Kohlenmonoxid im Blut allmählich abgebaut. Die Lungenfunktion beginnt sich nach etwa zwei rauchfreien Monaten zu verbessern. Eine Möglichkeit, die das Aufhören erleichtern kann, ist die sogenannte Nikotinersatztherapie. Sie lindert die Entzugserscheinungen, die sich durch den Rauchstopp einstellen. Nikotinpflaster und -kaugummi enthalten weniger Nikotin als Zigaretten und erhöhen – anders als das Rauchen – nicht den Kohlenmonoxidgehalt im Körper. Vier rauchfreie Wochen können die Komplikationsrate senken:7 ohne Beratung und Nikotinersatztherapie traten bei etwa 28 von 100 operierten Personen nach dem Eingriff Komplikationen auf; mit Beratung und Nikotinersatztherapie traten bei geschätzt 9 von 100 operierten Personen Wundheilungsstörungen auf.
Alkoholkranke Patienten:8
Alkoholkranke haben mit einer ganzen Fülle von erhöhten Komplikationen zu rechnen. Soweit nicht die Dringlichkeit der Versorgung dem entgegensteht, sollten Patienten grundsätzlich versuchen, vor einem operativen Eingriff möglichst mehrere Tage keinen Alkohol zu sich zu nehmen. Im Idealfall ist die komplette Woche vor der Operation alkoholfrei. Bei Alkoholkranken mit elektiven OP-Indikationen sollte geprüft werden, ob Zeit verbleibt, einen qualifizierten Alkoholentzug durchzuführen.
Drogen- / Substanzgewöhnte Personen:9
Wie oben bereits in den Empfehlungen der Fachgesellschaften 2024 ausgeführt „sollte bei Substanzabhängigkeit zur Risikoreduktion perioperativ der Substanzkonsum nach Möglichkeit fortgesetzt (z. B. Alkohol, Nikotin) oder substituiert (z. B. Opioide) werden. Neben Alkohol, Nikotin und Opioiden sind hierbei insbesondere Benzodiazepine, Gabapentinoide, Cannabinoide und Z-Substanzen von Bedeutung. Die bereits vorbestehende Opioideinnahme ist im Rahmen der präoperativen Risikoevaluation aufgrund einer möglichen Abhängigkeit, Toleranzentwicklung und psychosozialer Krankheitsaspekte von hoher Relevanz. Die Opioid-Abhängigkeit ist eine chronische Erkrankung mit wechselnden Phasen mit und ohne Konsum bzw. Substitution. Von zentraler Bedeutung ist bei diesen sehr Stress-reagiblen Patienten eine vertrauensvolle und enge Begleitung in der perioperativen Phase.“
Fazit:
Die heute vorliegenden wissenschaftlich belegten Daten und Empfehlungen zielen auf ein systematisches – überwiegend anamnestisches – Vorgehen bei der präoperativen Untersuchung und Vorbereitung der Patienten hin. Einfache, gezielt erhobene Daten, Untersuchungsbefunde und Scores sind in der Lage, Risikogruppen (z. B. hinsichtlich kardiopulmonaler perioperativer Komplikationen, Delir, Vormedikation, Substanzgebrauch etc.) zu identifizieren. Diese identifizierten Patienten sind aufzuklären und bestmöglich zu begleiten. Da nicht alle identifizierten Risiken kompensierbar sind, ist ggf. die Terminierung von Operationen abhängig zu machen von der Möglichkeit erweiterter Überwachung (IMC/ICU).
Literatur auf Anfrage bei der Redaktion.

Literatur
- Anaesthesiologie (2024) https://doi.org/10.1007/s00101-024-01408-2. Präoperative Evaluation erwachsener Patientinnen und Patienten vor elektiven, nicht herz-thoraxchirurgischen Eingriffen. Eine gemeinsame Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Volume 73, p. 294–323
- Das Risiko ist in den meisten hier eingegangenen Publikationen mit einem Studienendpunkt: „Tod durch kardio-vaskuläre Erkrankungen, Myokardinfarkt oder Schlaganfall“ innerhalb von 30 Tagen
- Herzinsuffizienz, Chronisches Koronar Syndrom (CCS), Zerebrale Insuffizienz (Apoplex oder TIA), Insulin-pflichtiger Diabetes mellitus, Kompensierte Niereninsuffizienz mit einem Serum-Kreatinin >2mg/dl
- „Zwei Stufen-Etagen“ können bewältigt werden (= 4 metabolische Äquivalente, vierfacher Ruheumsatz [(metabolic equivalent of task,MET ]), mehr als 100 Watt
- Oliveras, C., Cortez, P. R. G., Nuño, L, Colom, J., Kögel, C. C., Pascual, F., Fernández-Artamendi, S., Gual, A., Balcells-Oliveró, M. & López-Pelayo, H. (2024). High-Risk Cannabis Use: A Proposal of an Operational Definition through Delphi Methodology for Scientific Consensus. Eur Addict Res, 30, 288-301, https://doi.org/10.1159/000540541.
- IQWiG: https://www.gesundheitsinformation.de/kann-ein-rauchstopp-vor-einer-operation-komplikationen-vorbeugen.html#
- Thomsen T, Villebro N, Møller AM. Interventions for preoperative smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2014; (3): CD002294.
- https://www.springermedizin.de/emedpedia/detail/die-anaesthesiologie/anaesthesie-bei-patienten-mit-suchterkrankungen?epediaDoi=10.1007%2F978-3-662-45539-5_117
- Anaesthesiologie (2024) https://doi.org/10.1007/s00101-024-01408-2. Präoperative Evaluation erwachsener Patientinnen und Patienten vor elektiven, nicht herz-thoraxchirurgischen Eingriffen. Eine gemeinsame Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin